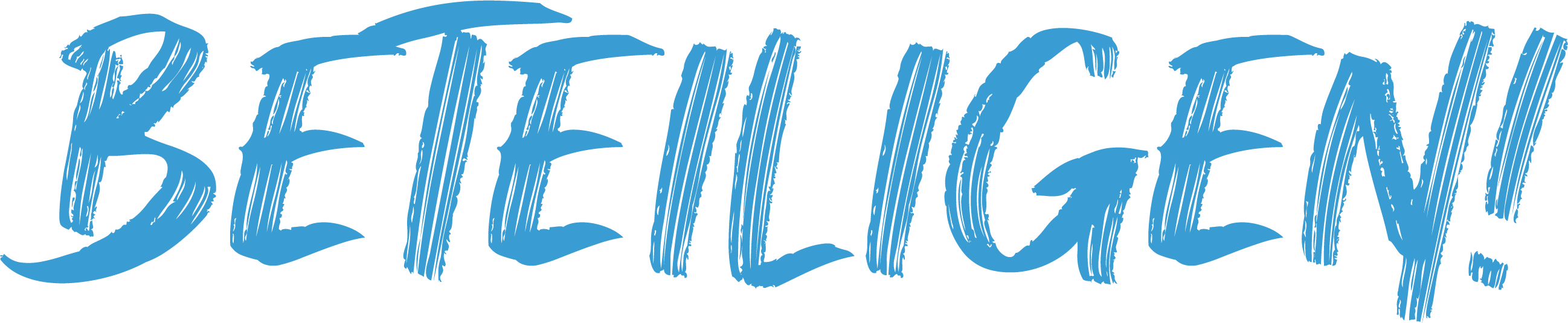Dass Transformationsprozesse ohne Beteiligung kaum erfolgreich sein können, ist eine Position die längst nicht alle politisch Verantwortlichen teilen. Tatsächlich geht der Trend in einigen Bereichen ja sogar in die gegenteilige Richtung: Beschleunigung von Transformation durch Rückbau demokratischer Rechte von NGOs und Bürger*innen.
Die Robert Bosch Stiftung hat hierzu kürzlich eine aktuelle Studie veröffentlich, die für eine frühzeitige, strukturierte Beteiligung der Öffentlichkeit bei zentralen Gesetzesvorhaben plädiert. „Gemeinsam voran – Deliberative Beteiligung in der Klimapolitik“ lautet der Titel. Und er ist Programm. So schreiben die Autor*innen:
„Deliberative Verfahren bieten geschützte Räume für den sachlichen Austausch von Argumenten und verschiedenen Perspektiven abseits des Mediendrucks und parteipolitischen Tagesgeschäfts. Dadurch fördern sie die Erarbeitung qualitativ hochwertiger und vielseitig akzeptierter Lösungen. Ein zunehmend bekanntes Beispiel für deliberative Beteiligung sind sogenannte Bürgerräte mit zufällig ausgewählten Teilnehmenden.“
Im Grunde ist das Dokument nicht wirklich eine Studie. Es ist weitgehend empiriefrei. Tatsächlich ist es ist eher ein – durchaus qualitativ hochwertiges – Konzept für die Etablierung von Deliberationsstrukturen in der klimawandelbedingten Transformation.
Dabei gehen die Autor*innen vom Ansatz der deliberativen Demokratie aus – die also auf die die Einbindung möglichst vieler Sichtweisen und Positionen fokussiert und sich vom Ansatz der partizipativen Demokratie unterscheidet, der möglichst vielen Betroffenen die Mitwirkung an sie betreffenden Entscheidungen ermöglichen will. Beide Ansätze unterscheiden sich, haben aber durchaus ihre Berechtigung. Deliberation setzt eher auf Konfliktradar, Akzeptanzförderung und Agenda-Setting (S. 6), Partizipation auf Konfliktaushandlung.
Die in der Studie vorgestellten Beispielprozesse setzen deshalb konsequent auf Zufallsauswahl, die letztlich sogar aus einem extra dafür entwickelten „stehenden Pool“ erfolgen soll, in den jährlich Bürger*innen und Bürger quasi “auf Vorrat” gelost werden sollen. Institutionell sollen die Prozesse an eine Zentrale Kompetenzstelle angebunden werden, die im Kanzleramt, in einem Querschnittsministerium oder bei einer eigenen Anstalt öffentlichen Rechts bzw. einer Bundesstiftung angesiedelt werden soll. Dazu sollen wissenschaftliche Begleit- und eher politische Steuerungskreise kommen.
Neben gelosten Bürgerräten sind ergänzend (ebenfalls geloste) Fokusgruppen gedacht. Dazu nicht öffentliche „Salons“ für gezielt einzuladende Stakeholder.
Die Studie stellt ein in sich geschlossenes Konzept für die deliberative Begleitung von klimawandelbedingten Transformationsprozessen dar. Sie ist ebenso umfassend wie konkret und damit absolut eine Leseempfehlung.
Ob am Ende angesichts der Tiefe der zu erwartenden Transformationen und der letztlich zu erwartenden umfangreichen Konflikte in und mit erheblichen Teilen der Bevölkerung Deliberation, also die Beteiligung weniger Ausgeloster oder Ausgewählter ausreicht, um „eine breite gesellschaftliche Zustimmung und Trägerschaft für Maßnahmen“ zu erreichen, darf kritisch hinterfragt werden. Es wäre jedoch nicht fair, dies den Autor*innen der Studie (Mitarbeitende von Klimamitbestimmung e. V. ) vorzuwerfen. Ihr Auftrag war ein anderer.