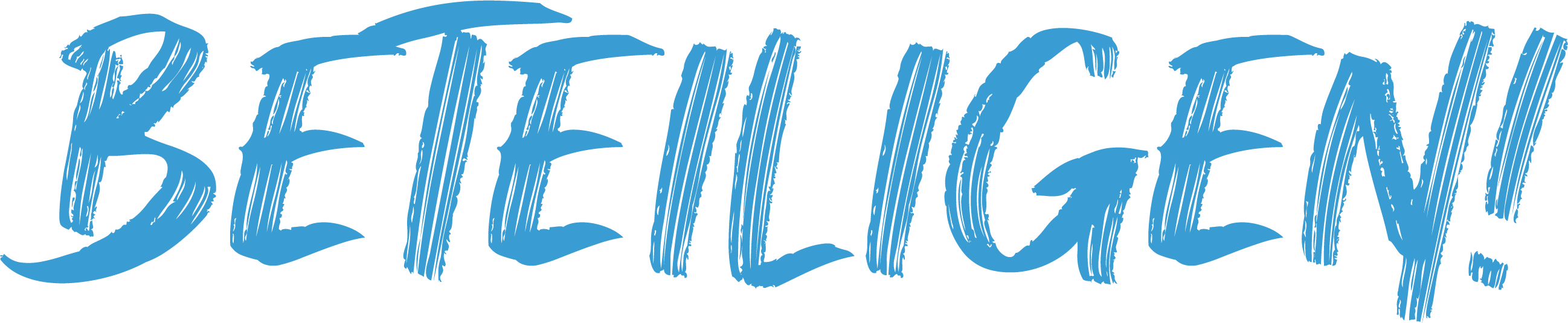Frau Weisband, lassen Sie uns zum Anfang betrachten, wie es der Demokratie gerade geht. Wie schätzen Sie aktuell die Lage in der Welt, in Europa, in Deutschland ein?
Wir leben im Präfaschismus. Wir haben einen konzentrierten Angriff auf Demokratien weltweit und das geht über einen Backlash hinaus. Faschistische Bewegungen nutzen den Backlash, sie planen aber das, was sie tun, schon seit sehr vielen Jahren. Aus meiner Sicht reicht es nicht, die Demokratie zu verteidigen. Die Demokratie ist, so wie sie war, gerade anfällig für das geworden, was wir aktuell erleben. Weil sie nicht für alle Menschen gerecht ist. Weil sich viele Menschen nicht repräsentiert fühlen.
Wir müssen Demokratie nicht nur verteidigen, sondern wir müssen Demokratie ausbauen und mehren.
Wir müssen unsere Art zu leben und zu wirtschaften anders gestalten, als wir es bislang getan haben. Wir können also nicht einfach zu einem Status quo zurückkehren, sondern gerade jetzt müssen wir das Übermorgen vorbereiten. Damit wir uns so aufstellen, dass wir nach diesem Backlash eine gerechtere Gesellschaft formen können.
Unsere Chancen stehen dafür gar nicht schlecht, denn historisch konnte man häufig eine Pendelbewegung in der Welt beobachten. Insgesamt müssen wir sehen, dass Gesellschaften tendenziell gerechter, liberaler und friedlicher werden. Ich habe eine positive Voraussicht auf das Übermorgen – das Morgen aber, also ungefähr die nächsten zehn Jahren, wird schwierig.
Somit heißt das aber auch, dass die Demokratie nicht ausgedient hat, oder?
Nein, die Demokratie als System hat überhaupt nicht ausgedient. Wir haben aber in letzter Zeit zu wenig Politik und zu viel Verwaltung in Deutschland. Wir haben eine Instandhaltung des Status quo ohne Visionen für die Zukunft. Ohne, dass man bei dem Top-Personal der gewählten Parteien wirklich das Gefühl hat, die machen das für eine Sache. Es ist sogar relativ schwierig, in der deutschen Politik zu überleben, wenn man es für eine Sache macht.
Und das ist ein riesiges Problem. Dadurch haben wir zu wenig Resilienz. Ich erlebe derzeit eine massive Hilflosigkeit seitens der Medien und Parteien, wie man den faschistischen Bewegungen begegnen kann.
Von einer Hilflosigkeit sprechen Sie auch oft an einer anderen Stelle, nämlich von der „Erlernten Hilflosigkeit“ – was meinen Sie damit?
Erlernte Hilflosigkeit ist etwas, das wir auf individueller Ebene beobachten können. Und zwar wenn wir lange in einer Umgebung aufwachsen, in der wir nichts verändern können und in der wir keine wirkliche Verantwortung für unser Lebensumfeld tragen. Dann haben wir, selbst wenn wir mit der Notwendigkeit und Möglichkeit konfrontiert werden, etwas zu verändern, nicht die Motivation dazu. Weil wir versuchen, Frust zu vermeiden. Denn wir haben ja gelernt, dass es sowieso nicht auf uns ankommt. Was wir zu sagen haben, ist egal und daraus ergibt sich, dass wir es gar nicht erst versuchen.
Das beobachte ich bei ganz vielen Schüler*innen von mir, vor allem bei den Älteren. Sie haben diese Hilflosigkeit schon gelernt. Sie wachsen in einer Umgebung auf, wo sie ihr Lebensumfeld ehrlicherweise kaum beeinflussen können: Sie müssen um 8 Uhr morgens da sein. Sie müssen 45 Minuten lang Mathe lernen. Und dann müssen sie in dieser 20-Minuten-Pause Hunger haben. Das heißt, sie sind da, um Erwartungen zu erfüllen. Und sie kriegen gute Noten und Belohnungen, solange sie das tun. Es wird aber gar nicht von ihnen erwartet, dass sie ihre Lebensumwelt gestalten, mit offenen Augen durch die Welt gehen, ihre Bedürfnisse formulieren und sich für ihre Mitschüler verantwortlich fühlen. Diese Form der Sozialisation, mit der wir schon das Leben in dieser demokratischen Gesellschaft anfangen, ist einem demokratischen Rollenbild gar nicht zuträglich.
Wenn man Ihnen so zuhört und Ihre Texte liest, so fällt auf, dass Sie sehr klar und verständlich argumentieren. Verständlich finden viele Menschen auch die Argumente der Populisten. Sprechen wir Demokraten zu kompliziert?
Ich glaube tatsächlich, wir brauchen diese Eigenschaft für die Demokratie. Ich versuche zu beobachten und herunterzubrechen. Die Erfahrung beispielsweise, was die Schule mit einem macht, hatte ich zuerst aus eigener Erfahrung. Ich bin ein Mensch, der es in seinem Leben recht schwer hatte. Ich habe das deutsche System sowohl von außen als auch von innen kennengelernt. Ich bin an die Schule gekommen, als ich noch gar kein Deutsch sprach. Ich musste sehr explizit lernen, was die Normsysteme hier sind. Die waren natürlich in der Sowjetunion und in meinem Zuhause ganz anders. Um mich sowohl zu Hause als auch in der Schule normgerecht zu verhalten, musste ich beides lernen.
Das ist eine Eigenschaft, mit der Migranten Deutschland ganz stark helfen können. Sie sind gezwungen, vieles explizit zu reflektieren, das für andere Leute normal ist und ihnen gar nicht auffällt. Deswegen entwickeln sie gar keine Sprache dafür. Ich war gezwungen, Sprache für viele Dinge zu entwickeln, die mir aufgefallen sind.
Zweitens glaube ich, dass es eine ganz grundlegende Eigenschaft einer demokratischen Person ist, die Fähigkeit zu entwickeln, zu verstehen, was ich brauche und was andere brauchen, und das formulieren zu können. Und dann auch die Kreativität zu entwickeln, sowohl zu sehen, wie die Welt ist, als auch zu sehen, wie die Welt sein könnte. Da gibt es eine Phrase von Maren Urner, die Neuropsychologin ist: Die mächtigste Frage, die wir uns stellen können, ist nicht nur „Was will ich?“, sondern „Was würde ich tun, wenn es mir wirklich darauf ankäme?“ Und ich glaube, da sind wir als Gesellschaft noch nicht. Beispielsweise wenn Politiker*innen sagen, wir bräuchten mehr Bildung, sich zu fragen, wie unsere Politik aussehen würde, wenn Bildung wirklich eine Priorität wäre.
Sie haben viele Projekte, insbesondere aula. Was haben Sie dort für besondere Erfahrungen gemacht?
aula ist das, was ich seit zehn Jahren hauptberuflich mache. Das ist mein Leben. aula ist ein Beteiligungskonzept, mit dem wir an Schulen bundesweit arbeiten und ich habe das Glück gehabt, einige dieser Schulen persönlich zu begleiten. Da habe ich viele spannende Erfahrungen gemacht.
Wenn Schüler*innen beispielsweise sagen, dass an einem Tag alle Lehrer*innen ihren Unterricht mithilfe des Smartphones machen sollen. Dann sind viele Lehrer*innen plötzlich aufgeschmissen, denn sie haben mit dem Gerät noch nie so gearbeitet. Sie wissen nicht, was sie damit machen sollen. Dann fangen Lehrer*innen plötzlich an, auf Social Media andere Lehrer*innen zu fragen, wie sie das machen, und sammeln dort Ideen.
Das Schöne ist, dass die Schüler*innen das beobachten. Sie beobachten, wie ihre Lehrer*innen mit seinem Nichtwissen umgeht. Wie recherchieren sie? Wie finden sie gute Quellen? Wie gucken sie, was passt und was passt nicht? Woher wissen sie, was Quatsch ist und was nicht? Das sind alles Dinge, die wir lernen müssen und die immer gefordert werden. Aber wir lernen sie praktisch nie am Modell. Denn die Menschen, die wir als Modell beobachten, sind die Lehrer*innen und die wissen ja immer schon alles. Aber das ist nicht, was Schule tun muss, wenn sie Kinder auf Berufe vorbereitet, die es noch gar nicht gibt.
Heutzutage sind Lebensentwürfe sind weniger gleich. Es ist alles viel schneller und weniger erwartbar. Darin liegt aber auch sehr viel Schönheit. Das müssen wir nicht beheben, sondern wir müssen lernen damit umzugehen. Menschen müssen heute stark lernen, mit Komplexität umzugehen. Aber das geht nicht, wenn wir sie immer von Komplexität abschirmen, weil wir fürchten, das würde die Kinder überfordern und sei zu komplex. Wir können Kinder auch nicht aus dem Straßenverkehr fernhalten, bis sie 18 sind, um sie dann plötzlich dort allein zu lassen. Das würde zu sehr vielen Todesfällen führen, aber so halten wir es mit der Demokratie.
Ich fand auch die Projekte sehr spannend, wo Schüler*innen über die Hausordnung debattiert haben. Also zum Beispiel, wo sie ein Handy benutzen dürfen. Es ist keineswegs so, dass sie das Handy überall benutzen wollen. Sondern sie wollen beispielsweise grüne, gelbe und rote Zonen. Sie wollen Zonen, die ganz handyfrei sind, denn sie verstehen, dass sie in der Pause sonst wahrscheinlich nicht so viel miteinander reden. Sie wollen das Handy aber auch für den Unterricht nutzen dürfen; das wäre eine gelbe Zone. Und sie wollen auch eine grüne Zone, um zu Hause anzurufen oder irgendwas zu checken.
Oder sie verbieten sich selbst das Kaugummi-Kauen, nachdem die Debatte eigentlich damit angefangen hat, dass sie sich das Kaugummi-Kauen erlauben wollen. Sie beschäftigen sich damit, gehen die Konsequenzen durch und kommen zum Schluss, dass sonst unter ihren neuen Tischen und Bänken überall die Kaugummis kleben. Am Ende stimmen sie ab und lehnen mehrheitlich das Kaugummi-Kauen ab.
Ein anderes tolles Beispiel ist, wenn sie über etwas abstimmen, das fast alle wollen, aber ein Kind ausschließen würde, weil es allergisch ist oder eine Angststörung hat. Da gab es das Beispiel mit dem Klassenhamster, den alle wollten. Aber weil ein Mädchen allergisch ist, haben alle direkt selbstverständlich gesagt, dass sie das nicht machen wollen. Da kann man live sehen, wie sie unaufgefordert Minderheitenschutz betreiben. Ich muss den Kindern nicht beibringen, dass Minderheitenschutz wichtig ist. Das Einzige, was ich ihnen beibringen muss, ist dem einen Namen zu geben: Minderheitenschutz. Aber diese Rechtsabwägung, dass unser kollektiver Wunsch vielleicht weniger wiegt, als das individuelle Recht einer Person am Unterricht teilzunehmen, können Kinder. Wir müssen ihnen hauptsächlich Räume geben, in denen sie Verantwortung tragen können. Das reicht schon.
Wir haben Ihnen die Grundsätze für die Qualität von Bürgerbeteiligung der Allianz für Vielfältige Demokratie geschickt. Können Sie mit solchen Ideen mitgehen?
Absolut! Ich finde es auch sehr wichtig, solche Grundsätze zu formulieren. Ich mache das in meiner Arbeit ebenfalls und ich habe mich auch in Ihren sehr wiedergefunden. Tatsächlich habe ich das beispielsweise bei klaren Zielen und Gestaltungsmöglichkeiten sogar noch sehr viel radikaler formuliert: Pseudobeteiligung ist schlimmer als gar keine Beteiligung!
Ich habe das hier im Münsteraner Bürgerrat erlebt, für den ich Flyer verteilt habe. Ich habe die Leute gefragt, ob sie nicht mitbestimmen wollen, wofür unser Haushalt ausgegeben wird. Die sind an mir vorbeigegangen und haben dankend abgelehnt. Da habe ich mich gefragt, warum das so ist. Mitbestimmen ist doch besser als nicht mitbestimmen. Und dann habe ich verstanden, dass es dort schon mal einen Beteiligungsprozess gab. Da gab es viele Leute, die sich Mühe gemacht haben. Die haben Vorschläge geschrieben, Ideen ausgearbeitet und waren vor Ort, um Dinge zu dokumentieren. Anschließend kam diese ganze Bürgerbeteiligung auf den Tisch der Verwaltung. Die hat dann gesagt, ja danke sehr, wir gucken nochmal. Und das war‘s. Wenn man für so eine Beteiligung Energie investiert und trotzdem gar nichts bei rum kommt, stärkt das den Frust und die erlernte Hilflosigkeit. Das ist aktiv schlimmer, als direkt zu sagen, dass sie deren Meinung nicht interessiert.
Haben Sie noch Tipps für Beteiligungsprozesse und für die vielen Praktiker*innen, die ja auch Mitglied bei uns im Fachverband sind?
Ich kann parallel zu Ihren zehn Grundsätzen, meine eigenen formulieren: Erstens, gute Beteiligung muss stetig sein. Man kann sich in die Rolle des demokratischen Bürgers nicht in einer Projektwoche oder in einem Planspiel sozialisieren. Sozialisation ist etwas, das stetig ist. Wo ich stetig die Möglichkeit habe, mich einzubringen, wo das einfach begleitend und ständig läuft.
Zweitens, gute Beteiligung ist verbindlich. Ich muss wissen, worüber ich mitbestimme. Natürlich gibt es viele Dinge, über die eine bestimmte Gruppe nicht allein bestimmen kann. Schüler*innen können zum Beispiel nicht über Dinge bestimmen, die nur der Schulträger entscheiden kann. Aber das müssen sie wissen. Sie müssen wissen, was ihr Spielraum ist. Sie müssen wissen, dass sie beschließen, einen Antrag zu stellen, aber nicht beschließen, dass dieser Antrag auch durchkommt. Das muss transparent sein.
Drittens muss gute Beteiligung vollständig sein. Das heißt, sie muss am Anfang beginnen. Beteiligung beginnt nicht mit der Frage, Schokoladen- oder Vanilleeis? Oder wollt ihr Effi Briest oder Faust lesen? Das führt zu sowas wie dem Brexit. Wenn ich Leuten einfach nur zwei Antwortalternativen gebe, führt das zu dummen Entscheidungen.
Beteiligung beginnt mit der Formulierung von Bedürfnissen und Interessen. Das ist die Basis für Kompromisse. Ich habe ein Bedürfnis und eine Idee, das Bedürfnis auf einen bestimmten Weg zu befriedigen. Wenn jemand anderes sagt, dass ihr dieser Weg nicht passt, können wir schauen, wie wir dieses Bedürfnis der anderen erfüllen können. Der Kern der Beteiligung liegt genau in diesem Aushandlungsprozess. Die Abstimmung, die konkrete Entscheidungsfindung ist nur der Schlussakkord. Die Meinungsbildung davor ist die Essenz der Beteiligung. Da beginnen Prozesse oft viel zu spät.
Viertens, gute Beteiligung muss niedrigschwellig sein. Sie muss als eine Art Einstiegsdroge funktionieren. Ich habe beispielsweise aula so gestaltet, dass die niedrigschwelligste mögliche Beteiligung ein Klick ist: Ich stimme für oder gegen eine Idee. Selbst wenn Schüler*innen völlig desinteressiert sind, bekommen sie es im Unterricht mit. Das ist wichtig! Man muss Beteiligung sogar passiv mitbekommen, wenn man nicht daran teilnimmt.
Und irgendwann bekommen sie mit, dass das Fußballtor abgebaut werden soll. Da stimmen sie mit nein. Aber dann haben sie sich schon eingeloggt und sind auf der Plattform. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine zweite Abstimmung machen, ist dann höher. Genauso ist dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Verbesserungsvorschlag liken, höher. Wenn sie einen Verbesserungsvorschlag geliked haben, ist der Weg nicht mehr weit, selbst einen zu schreiben. Wenn sie dann schon mal einen Vorschlag geschrieben haben, können sie auch eine eigene Idee formulieren.
Es darf in Beteiligungsprozessen also möglichst wenig Schwellen geben, an denen sich entschieden muss, ob man Teil dessen ist oder nicht. Wir werden niemals alle in die Beteiligung bekommen, aber ich möchte nicht, dass Leute an dieser Schwelle scheitern.
Am Ende stehen ja häufig politische Entscheider*innen, wenn es darum geht, Beteiligungsprozesse umzusetzen oder nicht. Wie können wir es schaffen, diese wunderbaren Ideen auf struktureller Ebene umzusetzen?
Ich finde nicht, dass wir auf Politiker*innen warten sollten. Wir haben gelernt, dass das Warten auf Institutionen gerade nicht so fruchtbar ist.
Demokratie ist nichts, das abgewartet wird. Demokratie ist etwas, das erkämpft wird.
Wenn ich genug Leute organisiere, eine Mehrheitsmeinung forme und Druck auf die Politik mache, dann reagiert sie darauf. So weit sind wir noch. Aber das ist ein Luxus. In der Ukraine ging das nicht, als ich dort aufwuchs. In Russland geht das nicht. Bei uns geht es noch und diesen Moment müssen wir nutzen. Wir können nicht warten, bis ein Stadtrat ein Beteiligungsformat erlaubt. Die Reihenfolge muss anders sein: Wir machen das Beteiligungsformat und konfrontieren den Stadtrat mit dem Ergebnis.
Man kann natürlich bei Politiker*innen an die Tür klopfen und erklären, dass die Zufriedenheit mit dem, was hier gerade läuft, massiv sinkt. Und dass der einzige Weg, dem zu begegnen und die Leute aus dieser gefühlten Ohnmacht heraus zu bekommen, ist, sie zu beteiligen. Dann kann man sagen, entweder machen Sie das oder die politische Karriere ist in Gefahr. Das ist ein sehr starkes Argument. Es ist nur meine Erfahrung, dass viele Leute für dieses Argument nicht empfänglich sind, bis es zu spät ist.
Ich bin ein großer Fan davon, lieber um Entschuldigung zu bitten als um Erlaubnis. Die einzige Möglichkeit, um das Morgen als Demokratie zu überleben, ist hinzugehen und Dinge zu tun. Denn die Institutionen sind langsam und bürokratisch. Bürokratien leben davon, sich selbst zu erhalten; an jedem Zweck vorbei. Es ist einer Bürokratie völlig egal, was sie tut, Hauptsache sie existiert. Aber es ist nicht in unserem Interesse, die Bürokratie zu erhalten. Es ist in unserem Interesse, die Demokratie zu erneuern. Und manchmal müssen wir dafür an der Bürokratie vorbei arbeiten.
Was wollen Sie den Menschen, die sich für Demokratie engagieren, zum Schluss noch mitgeben?
Ich denke, wir müssen radikaler werden. Wir müssen viel mehr zu dem Punkt gehen, was wir eigentlich wollen, warum wir das wollen, und was wir tun würden, wenn es uns wirklich darauf ankäme. Und diese Botschaften müssen wir in dieser Klarheit formulieren. Wir sprechen in der Demokratie viel zu oft von Akademiker*innen zu anderen Akademiker*innen. Das ist und bleibt eine Krankheit, trotz vieler Bemühungen, das anders zu machen.
Wir sind aber mit einer faschistischen Bewegung konfrontiert, die das ganz anders macht. Die einfach Lügen verbreitet. Die faktische Lügen und emotionale Wahrheiten leicht verständlich formuliert. Wir müssen das Gleiche tun, aber ohne die faktischen Lügen. Wir müssen die emotionalen Wahrheiten formulieren.
Es gilt in Deutschland als schicklich und als professionell, keinerlei emotionale Kommunikation zu machen, sondern immer auf der rationalen, faktischen Ebene zu bleiben. So kommuniziert unsere Politik. Aber Emotionen sind fester Bestandteil von Rationalität. Emotionen sind das, was uns überhaupt erst motiviert. Rational ist immer erst, was unserer Motivation dienlich ist. Die Motivation selbst ist immer Emotion.
Wir müssen als Leute, die für Demokratie kämpfen, viel emotionaler werden.
Donald Trump fängt ja immer an, irgendeinen Bullshit zu erzählen. So viel, dass man gar nicht hinterherkommt, dem zu nicht begegnen. Ich habe mal das gleiche mit Fakten über Koalas versucht. Ich hatte ein Gespräch mit einem sehr unangenehmen Menschen, der furchtbare Dinge gesagt hat. Ich habe ihn unterbrochen und ihm meine Lieblingsfakten über Koalas erzählt. Faktisch war alles falsch, was ich gesagt habe. Aber es hat gewirkt. Das war zwar durch und durch ein politischer Mensch, in Debatten geschult bis zum Anschlag, aber meinem Koala-Monolog konnte er gar nichts erwidern, weil er auf diese Situation nicht vorbereitet war.
Das ist ein Mittel, das wir viel häufiger gebrauchen müssten. Die Rechten haben „flood the zone with shit“ als Propagandatechnik. Wir könnten „flood the zone with love and kindness“ nutzen. Einfach radikal in das reingehen, wofür wir sind und allen Leuten begeistert erzählen, warum wir dafür sind. Auf einer leicht verständlichen Ebene, weil es aus dem Herzen kommt. Wir können diesen Inhalt des Herzens mit allen Bildungsschichten und Hintergründen teilen. Wir müssen viel radikaler in der Art werden, wie wir für Dinge schwärmen, wie wir Dinge lieben und wie wir an Dinge glauben.