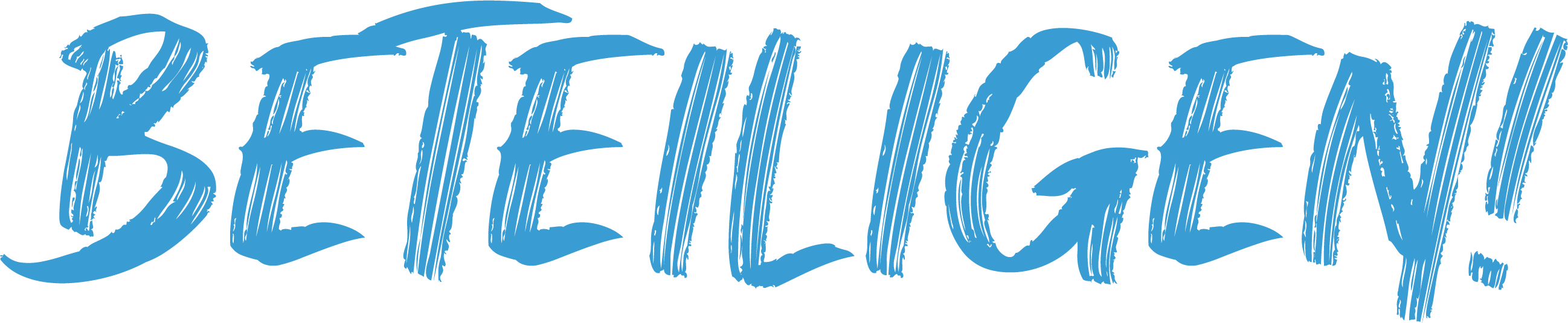Inklusion ist ein Thema, das Kommunen beschäftigt. Welches Sind die Rahmenbedingungen und Grundlagen für die Umsetzung?
Das das zentrale Fundament für die Inklusionspolitik in Deutschland ist die Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Mit ihrer Ratifizierung im Jahr 2009 verpflichtete sich die Bundesrepublik, Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt in allen gesellschaftlichen Bereichen zu beteiligen – ob Bildung, Arbeit, Wohnen oder politische Teilhabe. In Artikel 29 fordert die UN-BRK ausdrücklich, dass Menschen mit Behinderungen effektiv und umfassend an politischen und öffentlichen Angelegenheiten beteiligt werden.
Für Städte und Gemeinden bedeutet dies nicht nur Anpassung bestehender Angebote, sondern die strukturelle Veränderung von Verfahren, Sprache, Zugangsmöglichkeiten und Entscheidungsstrukturen. Bürgerbeteiligung wird damit zur Schlüsselstrategie der Umsetzung.
Welche Rolle haben Inklusionsbeauftragte dabei?
Die Aufgabe der Inklusionsbeauftragten besteht darin, diesen Anspruch in lokale Maßnahmen zu übersetzen und dauerhaft im Verwaltungshandeln zu verankern.
Seit meiner Berufung zum Inklusionsbeauftragten der Stadt Pforzheim im Februar 2019 arbeite ich daran, Inklusion in allen Bereichen der Stadtpolitik zu verankern.
Inklusion verstehe ich nicht als abstraktes Ideal, sondern als konkrete demokratische Verpflichtung.
Ich orientiere mich dabei an den vier zentralen Prinzipien, die Beate Rudolf 2017 als Grundlage kommunaler Inklusionspolitik formuliert hat: Pflichtcharakter, Universalität, Selbstbestimmung und Verantwortung.
Pflichtcharakter meint, dass Inklusion ist kein freiwilliger Akt oder gutgemeintes Zusatzangebot ist , sondern eine rechtlich verankerte Verpflichtung. Kommunen und staatliche Akteure haben die Aufgabe, Maßnahmen zu ergreifen, die gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen.
Universalität sieht Inklusion nicht als exklusives Konzept für Menschen mit Behinderung, sondern richtet sich an alle, die gesellschaftlich marginalisiert werden – sei es aufgrund von Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion, Armut oder anderer Faktoren. Sie betont die Gleichwertigkeit aller Menschen und erkennt Unterschiedlichkeit als Normalität an. Damit ist Inklusion auch ein Schutzmechanismus gegen Diskriminierung und eine ethische Leitlinie für kommunale Sozialpolitik.
Selbstbestimmung meint nicht bloß Zugang zu bestehenden Angeboten, sondern die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie, wo und mit wem man leben, arbeiten oder lernen möchte. Autonomie ist dabei kein abstrakter Begriff, sondern Alltagspraxis:
Die Verantwortung für Inklusion schließlich liegt nicht bei den Betroffenen, sondern bei der Gesellschaft als Ganzem – insbesondere bei ihren Institutionen. Der Staat und seine Kommunen müssen Rahmenbedingungen schaffen, die Inklusion ermöglichen – durch Ressourcen, politische Prioritätensetzung und strukturelle Veränderungen. Das bedeutet auch, Macht und Gestaltungsspielräume bewusst zu teilen und offen für Kritik und Weiterentwicklung zu bleiben.
Inklusion heißt deshalb für mich, Räume zu schaffen, in denen alle Menschen – insbesondere jene, die bisher ausgeschlossen waren – ihre Stimme erheben, gehört werden und mitbestimmen können.
Was bedeutet Inklusion für die kommunale Bürgerbeteiligung?
Der folgende Inhalt ist nur für unsere Mitglieder zugänglich. Bitte logge dich ein, wenn du Mitglied im Fachverband Bürgerbeteiligung bist.