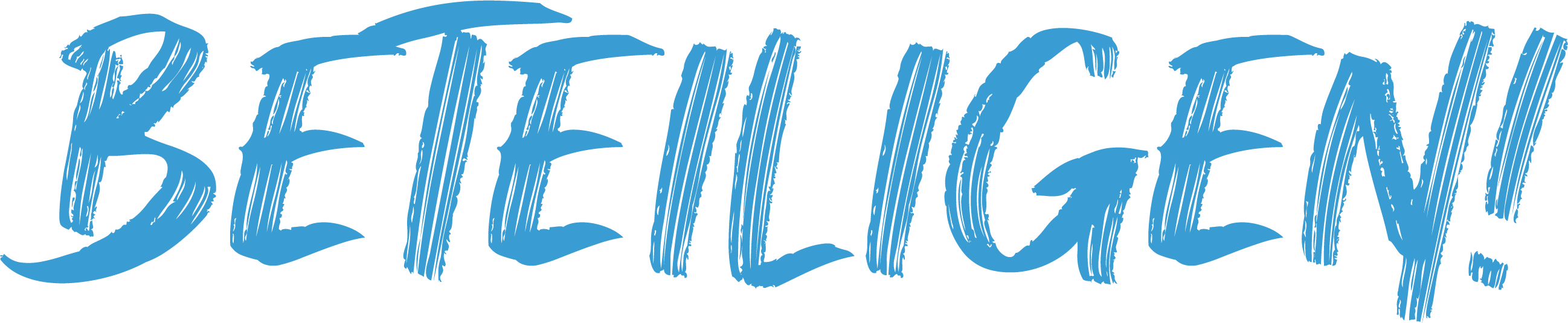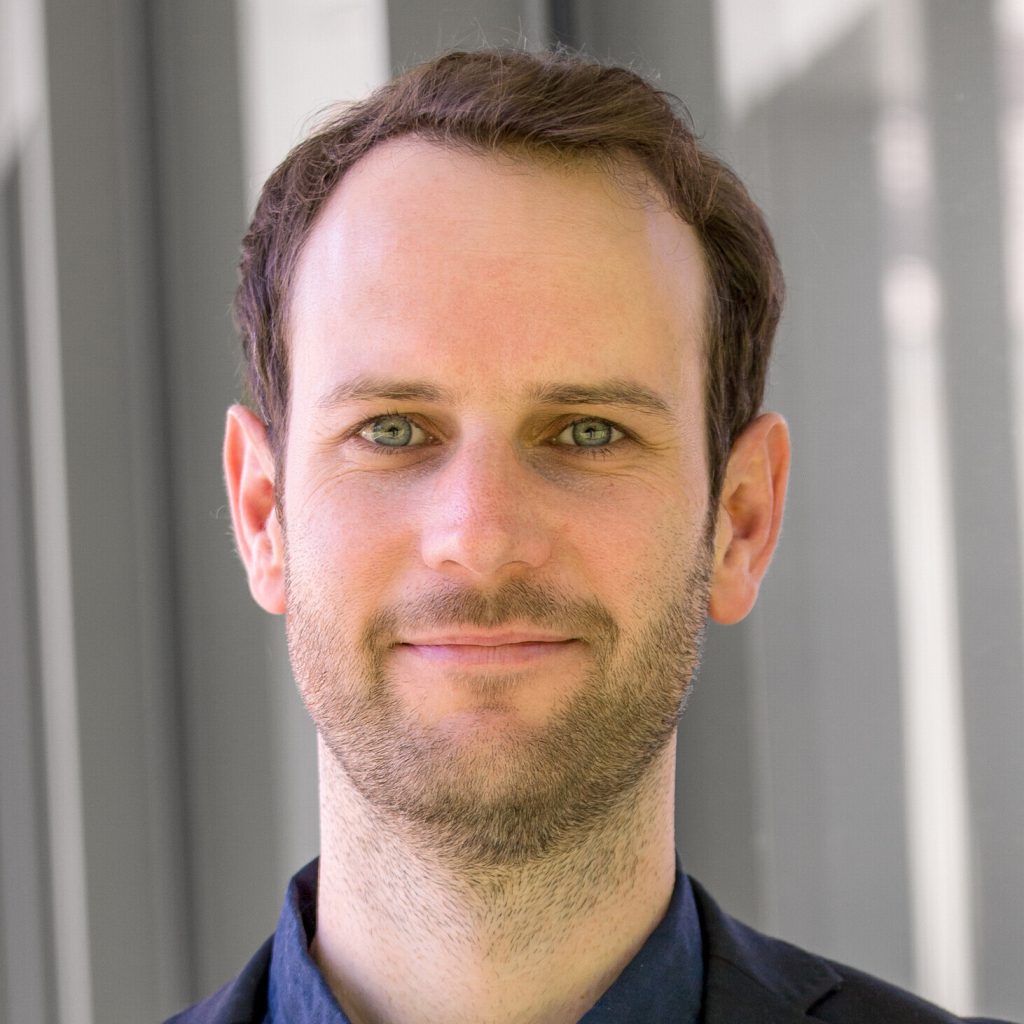2024 haben wir bei Mehr Demokratie e. V. das Projekt „Gespräche von Mensch zu Mensch – weil wir hier leben” gestartet. In der Pilotphase hatten wir zum Ziel: Erfahrungen sammeln, das Dialogformat »Sprechen & Zuhören« weiter erproben, Herausforderungen identifizieren und – das wird immer deutlicher – dem gesellschaftlichen Momentum folgen. Wir bekommen sehr viel positive Resonanz, die uns in unseren Aktivitäten bestärkt. Gleichzeitig fragten wir uns von Beginn an: Was genau ermöglicht diese oft tiefgehenden Begegnungen bei »Sprechen & Zuhören«, selbst zwischen Menschen mit weit auseinanderliegenden Meinungen? Eine kurze Antwort lautet: Es ist mehr als nur die Methode. Der Erfolg hängt auch maßgeblich von der inneren Haltung der Moderierenden ab.
»Sprechen & Zuhören« im Projekt „Gespräche von Mensch zu Mensch – weil wir hier leben”
Seit Anfang 2024 haben in über 45 kommunalen Dialogveranstaltungen in mehr als 25 verschiedenen Gemeinden und Städten mehr als 1100 Menschen an »Sprechen & Zuhören« teilgenommen. Diese Präsenzveranstaltungen, bei denen zwischen 10 und 80 Menschen vor Ort waren, organisieren wir in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, wie Bürgermeister*innen, Partnerschaften für Demokratie oder zivilgesellschaftlichen Initiativen. Zusätzlich laden wir von Mehr Demokratie aus einmal im Monat online zum »Sprechen & Zuhören« zu einem aktuellen politischen Thema ein – mit jedes Mal mehr als 150 Teilnehmenden.
Bei den Veranstaltungen wurden verschiedene, teils sehr kontroverse und polarisierende Themen behandelt, wie die Corona-Politik, das Ost-West-Verhältnis, Rechtspopulismus, Migrationspolitik und Israel–Palästina. Aber auch vermeintlich einfachere und weniger emotional aufgeladene Themen wie Demokratie und Lokalpolitik waren Gegenstand. Unsere Intention war und ist es, eine demokratische Verständigung zu ermöglichen, wofür die Erfahrung von Verbindung und Zugehörigkeit ein wesentliches Fundament ist.
»Sprechen & Zuhören« selbst gibt eine Struktur vor, die allen die gleiche Redezeit ermöglicht, persönliches Teilen und aktives Zuhören fördert, ist aber auch durchaus anspruchsvoll. Denn die Teilnehmenden sind angehalten, von ihren eigenen Erfahrungen und persönlichen Empfindungen in Bezug auf ein politisches Thema zu sprechen. Das kann insbesondere für Menschen, die sich normalerweise wenig oder nicht am öffentlichen Leben beteiligen, ungewohnt und auch herausfordernd sein. Gerade dann ist es wichtig, dass die Moderation ein Gefühl von Sicherheit vermittelt und allen Menschen mit einer Haltung offener, einladender und authentischer Präsenz begegnet.
Es ist uns gelungen, dass sich Menschen auch im ländlichen Brandenburg – wo wir die meisten kommunalen Dialoge durchgeführt haben – trotz stark polarisierter Meinungen auf der menschlichen Ebene begegnen: „Ich sehe dich als Mensch. Selbst wenn ich deine Position nicht teile!“ Diese Aussage ist nicht nur ein Ergebnis von »Sprechen & Zuhören«, sondern sie bringt auch unsere demokratische Haltung zum Ausdruck, wenn wir moderieren: Ich muss die Meinung des anderen nicht teilen, um mit ihm in Kontakt zu treten und das Menschliche in ihm wertzuschätzen. An dieser Haltung orientieren wir uns und glauben, dass sie ein wichtiges Element der Stärkung der Demokratie in Zeiten von gesellschaftlicher Polarisierung und Fragmentierung ist.
Die Haltung – wichtiger als die Methode
Das Format haben wir mittlerweile in mehreren kostenfreien Fortbildungen an über 400 Moderator*innen vermittelt. Dabei haben wir wichtige Erkenntnisse gewonnen: Es ist anspruchsvoller, politische Themen zu moderieren als rein wirtschafts- oder organisationsbezogene. Der politische Raum ist deutlich spannungsreicher und unsicherer als beispielsweise Workshops in Unternehmen. Und: Das Format ist wichtig, aber der Schlüssel zum Erfolg liegt in der inneren Haltung der Moderierenden.
Natürlich entwickelt jede und jeder einen eigenen Moderationsstil und hat eigene Begrifflichkeiten, um die Haltung beim Moderieren zu beschreiben. Was wir als demokratische Haltung bezeichnen, lässt sich in drei Qualitäten zusammenfassen: Zugewandt bleiben, gelassen sein und Wertschätzung aller Beiträge. Wir begegnen den Menschen mit der Grundannahme, dass ihre heutigen Überzeugungen in ihrer Biografie begründet sind. Alle haben ein Gewordensein, das dazu führt, dass sie so denken, wie sie denken. Diese Akzeptanz ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Zustimmung zu allen Aussagen, sondern eine Anerkennung des Menschen hinter der Meinung.
Entscheidend ist, dass wir nicht versuchen, eine Meinung oder Einstellung zu verändern, sondern dass wir uns auf die anderen Menschen, den Prozess der Begegnung und das Gespräch einlassen. Wir kultivieren eine freudige, demütige und interessierte Haltung an der Vielfalt der Biografien, Menschen, Lebenshintergründe, Erfahrungen und Meinungen.
Wie gelingt es, eine solche Haltung beim Moderieren zu verkörpern? Es beginnt mit bewusster Vorbereitung – bereits am Vortag stellen wir uns mental auf die Rolle als Gastgeber*in ein und visualisieren den kommenden Dialog. Wir stellen uns den Raum vor, wie viele und welche Menschen kommen könnten und was sie bewegen könnte. Unmittelbar vor einem Dialog machen wir oft kurze Achtsamkeitsübungen, um das eigene Nervensystem zu regulieren. Sobald die Teilnehmenden eintreffen, beginnt die Moderation bereits mit der Begrüßung, oft mit Handschlag – dem ersten nonverbalen Kontakt. Wir versuchen, die Atmosphäre im Raum wahrzunehmen, uns einzustimmen und uns vorzustellen, wie der Raum sich mit Gesprächen füllen wird.
Authentische Präsenz statt Agenda
Was nicht funktioniert: Eine Haltung geprägt von Angst, dem Drang zu helfen, eine eigene Agenda zu verfolgen oder die Überzeugung, zu wissen, was richtig und was falsch ist. Menschen spüren sofort, wenn sie nicht wirklich gemeint sind. Wer die demokratische Haltung nicht verinnerlicht hat, wird das schnell an den Reaktionen im Publikum erkennen: Widerstand, kritische Fragen, Zwischenrufe oder bewertende Bemerkungen.
Die Entwicklung dieser Haltung ist ein Prozess: Jahre innerer Arbeit, kontinuierliches Training und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Im Wort „Haltung“ steckt auch der Halt – wie ein Geländer bieten uns die demokratischen Werte von Selbstbestimmung, Gleichheit und Gemeinschaft Orientierung. Sie erinnern uns daran, dass auch Menschen mit scheinbar abwegigen Meinungen eine Stimme der Gesellschaft sind und es wichtig ist, auch sie zu hören.
Umgang mit Herausforderungen
Ist uns das immer gelungen? Nein, natürlich machen auch wir Fehler, sind unkonzentriert oder unsicher und lernen dazu. Mal wird eine Frage zu schnell abmoderiert, mal ein Kommentar zu lange geduldet. Wichtig ist die Bereitschaft zur Reflexion und zum Weiterlernen.
Häufig werden wir gefragt: „Was tun, wenn jemand rassistische oder menschenverachtende Äußerungen macht?“ Obwohl dies in unseren Veranstaltungen bisher nicht vorgekommen ist, haben wir eine klare Grenze: ehrverletzende, beleidigende, volksverhetzende oder rassistische Kommentare dulden wir nicht. Die Struktur des Formats, die auf persönliche Erfahrungen statt auf abstrakten politischen Diskurs zielt, macht das Einbringen reiner ideologischer Parolen aber erfahrungsgemäß sehr schwierig.
In Momenten hoher Spannung braucht es eine Moderation, die Sicherheit ausstrahlt. Fehlt diese, übernehmen oft Teilnehmende die Führung – nicht immer konstruktiv. Aber wir vertreten die Auffassung, dass man den Menschen auch etwas zumuten kann. Das Format ist auch eine Selbsterfahrung, in der die Teilnehmenden etwas darüber lernen können, wie Begegnung gelingt oder scheitert.
Ausblick
Wir erleben im Moment eine wachsende Bewegung zur Stärkung der demokratischen Kultur. Dazu werden wir weiter beitragen, indem wir weiterhin Kurzfortbildungen in »Sprechen & Zuhören« anbieten, wodurch unsere Community of Practice weiter wachsen wird: Ausgebildete Moderator*innen organisieren selbständig Dialoge, treffen sich in Regionalgruppen (z. B. in NRW, Hessen, Schleswig-Holstein und Niedersachen) und online, um zu üben und sich auszutauschen. Wir unterstützen dies durch zweiwöchentliche Zoom-Treffen, eine Messenger-Gruppe mit über 100 Mitgliedern, eine gemeinsame Datenablage und individuelle Beratung. Der Leitfaden für das Format ist außerdem hier online verfügbar.
Ist »Sprechen & Zuhören«, getragen von dieser Haltung, die Lösung für alle gesellschaftlichen Spannungen? Nein, aber es ist ein wichtiger Baustein für eine demokratische Kultur, die auf aktivem Zuhören, Respekt und der Fähigkeit zur menschlichen Verbindung trotz Differenzen basiert. In Zeiten zunehmender Polarisierung, in der wir es gewohnt sind, uns voneinander abzuwenden, kultivieren wir dadurch eine Praxis der Zuwendung.