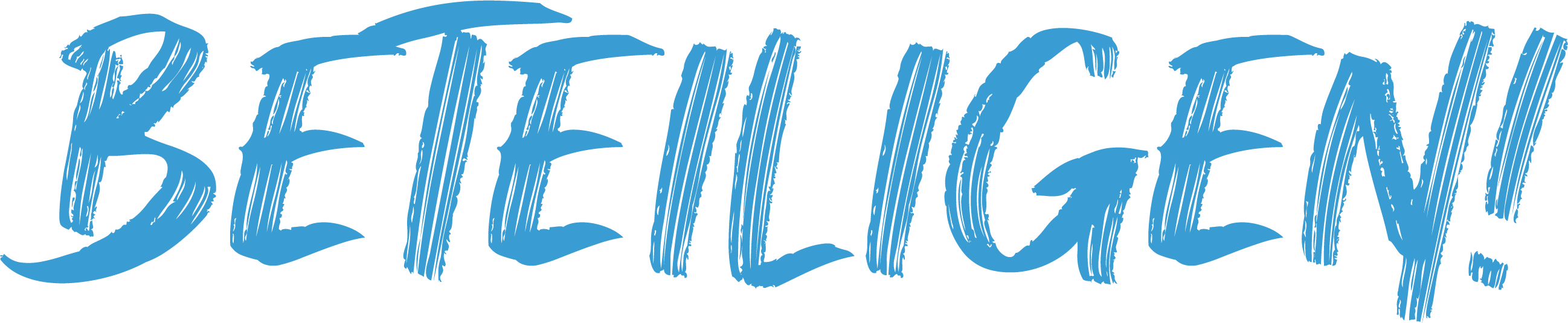Dass dieser Transformationsprozess ebenso alternativlos wie herausfordernd ist, ist vielen Akteuren in der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft klar. In der Wirtschaft hat sich diese Erkenntnis bislang nur zögerlich durchgesetzt, in der Politik bestimmt sie zwar häufig die Sonntagsreden, nur in geringem Umfang aber das gesetzgeberische Handeln. In großen Teilen der Bevölkerung ist das Bewusstsein dafür, wie tiefgreifend die nötigen Umgestaltungen ausfallen werden, kaum vorhanden.
Ohne dieses Bewusstsein werden die notwendigen Prozesse jedoch, insbesondere in demokratisch verfassten Gesellschaften, von der Politik kaum ernsthaft angestoßen. Geschähe dies wider aller Erwartungen doch, wären tiefgreifende Verwerfungen und Spaltungen die unmittelbare Folge. Wie also kann der Transformationsprozess zu einer nachhaltigen Gesellschaft gelingen? Hier gibt es im Grunde drei mögliche Ansätze, die wir im Folgenden betrachten wollen.
Der Top-Down-Ansatz
Unser modernes repräsentatives parlamentarisches System basiert auf gewählten Volksvertretern. Diese werden mittels eines in bestimmen Zyklen auftretenden Wahlaktes von Bürger*innen legitimiert. Macht ihres Amtes erlassen diese Repräsentanten Gesetze und steuern so von Oben (top) gesellschaftliche Reformen, die schließlich die Lebenswirklichkeiten der Bürger*innen beeinflussen.
Partizipation findet statt, allerdings als eher passives Konzept und beschränkt sich auf einen Akt: Mit einem Wahlmandat geben Bürger*innen Verantwortung an eine politische Elite ab, die innerhalb einer Legislaturperiode weitestgehend politische Autonomie genießt. Dieses System steigert Effizienz und gewährleistet Stabilität. Das Prinzip repräsentativer Demokratie ist größtenteils unstrittig – kaum jemand möchte ernsthaft zurück zur Hypertrophie der plebiszitären Komponente in der direkten Demokratie der griechischen Polis.
Der Vorteil eines solchen Systems ist die relativ große Macht der Regierenden. Sie haben die – theoretische – Möglichkeit, notwendige – wenn auch möglicherweise unpopuläre – Maßnahmen zu beschließen und durchzusetzen. Ohne Zweifel können so zum Beispiel dort, wo die Natur im gesellschaftlichen Handeln oder der unternehmerischen Kalkulation häufig das Nachsehen hat, strenge staatliche Regeln helfen. Ohne ambitionierte Umweltgesetzgebung oder der Subventionierung innovativer, ressourcensparender Technologien könnten die destruktiven Folgen eines ungezügelten Wachstums nicht abgefedert werden. Allerdings ist diese Form politischer Gestaltung bislang offensichtlich wenig erfolgreich. Letztlich korrespondiert der Höhepunkt zum Beispiel des globalen CO2-Ausstoßes ausgerechnet mit dem „Siegeszug“ demokratischer Staaten in den letzten 50 Jahren. Kaum ein gewählter Politiker traut sich, die nötigen Maßnahmen ernsthaft zu ergreifen. Er ist zu vielen Lobbyisten und Stakeholdern verpflichtet und vor allem hat seine Wiederwahl fest im Blick. Würde er nicht so denken, stünde seine politische Karriere schnell auf der Kippe.
Hinzu kommt die zentrale Schwäche der repräsentativen Politik: Die Betroffenen sollen letztlich erheblich Einschnitte in ihre Lebensführung akzeptieren, werden aber nicht wirklich gefragt. Das funktioniert schon mehr schlecht als recht in akuten Krisen wie z. B. der Corona-Pandemie. Dort geht es nur um verhältnismäßig minimale Einschränkungen über einen begrenzten Zeitraum. Das, was die Transformation uns jedoch abverlangt, ist einerseits dauerhaft, andererseits ein Vielfaches mehr, als nur eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Öffentlichkeit. Konsumverhalten, Arbeitsleben, Soziale Sicherung, Mobilität – es gibt keinen gesellschaftlichen Bereich, der nicht vollständig neu gedacht und organisiert werden muss. „Top-down” funktioniert das nicht.
Der Bottom-Up-Ansatz
Denken wir die partizipativen Prozesse also einfach einmal komplett andersherum. Eine Idee, die nicht erst seit dem Wachsen der Fridays4Future Bewegung an Attraktivität gewonnen hat. Tatsächlich ist es so, dass eine Transformation nur als gemeinsamer Prozess denkbar ist. Da scheint die Forderung nach direktdemokratischen Entscheidungen nur logisch zu sein.
In der Tat bergen plebiszitäre Strukturen wichtige Potenziale. So erhoffen sich Befürworter*innen vor allem eine schnellere und effizientere Entscheidungsfindung in dringlichen Nachhaltigkeitsfragen. Umweltgesetze stehen zwar oft oben auf der politischen Agenda, werden aber meist schleppend oder unvollständig verabschiedet. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der Umweltschutz mit Wirtschaftsinteressen kollidiert und im Zweifelsfall häufig das Nachsehen hat. In den meisten Fällen bestimmt die Wirtschaftslobby das Gesetzgebungsverfahren stärker als die Stimmen kleiner Naturanwälte. Der Erfolg zum Beispiel des Bienen-Volksbegehren in Bayern unterstreichen diesen Ansatz. Befürworter*innen direktdemokratischer Verfahren gehen davon aus, dass den Bürger*innen Umweltfragen mehr am Herzen liegen als die Aufrechterhaltung der Privilegien einzelner Wirtschaftszweige.
Hinzu kommt, dass direktdemokratische Verfahren bildungspolitische Effekte haben können. Die repräsentative Demokratie scheitert daran, einen nachhaltigen Bewusstseinswandel herbeizuführen. Demgegenüber müssten sich die Bürgerinnen und Bürger in einem plebiszitären System aktiv mit umweltpolitischen Sachfragen beschäftigen. Im Idealfall entwickeln aktive Bürgerinnen und Bürger in diesem System ein tieferes Verständnis für die Ziele ökologischer Nachhaltigkeit. Damit könnten sie den Grundstein für den längst überfälligen gesellschaftlichen Kulturwandel legen.
Doch auch der „bottom-up“-Ansatz birgt Risiken. So nützt die direkte Demokratie der Umwelt nur dann, wenn die teilnehmenden Akteure auch mehrheitlich tatsächlich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Vor allem für ökologische Ziele ist die Motivation der Menschen jedoch weitaus weniger optimistisch einzuschätzen als zuweilen angenommen. Zwar gibt es regelmäßig bei Umfragen hohe Zustimmungswerte für Forderungen nach mehr Umwelt- und Klimaschutz. Geht es jedoch an den eigenen Geldbeutel oder die eigene Bequemlichkeit, wird daraus schnell Ablehnung. Noch immer geht der Trend zum SUV statt zum Elektroauto, noch immer tendiert die Bereitschaft zum Konsumverzicht oder dem teureren, weil ökologischeren Produkt gegen null. Diese Lücke zwischen vorgeblicher Erkenntnis und Verhaltensänderung ist dramatisch. Zu glauben, ein Volk von Konsument*innen, SUV-Fahrer*innen und Billigfleischesser*innen würde seine plötzlichen direktdemokratischen Optionen dazu nutzen, diesen Lebenswandel abzuschaffen, ist kaum realistisch. Im Gegenteil: Die Gefahr, dass bei zunehmenden Belastungen populistische Mehrheit zu Stande kommen, ist groß. Es gibt Gründe dafür, dass ausgerechnet die AfD am lautesten direkte Demokratie fordert und gleichzeitig den menschengemachten Klimawandel leugnet.
Ohnehin lassen sich hochkomplexe Umweltfragen und der nötige grundlegende Kulturwandel nicht durch einfache „Ja-Nein“-Entscheidungen beantworten. Sie verlangen Abwägungsprozesse und Dialoge. Dass sich die direkte Demokratie jedoch nicht sonderlich gut für Kompromisse und Mediation eignet, hat Giovanni Sartori mit seiner historischen Analyse der Stadtstaaten (Polis) im antiken Griechenland bereits gezeigt. Die dort vorherrschende „Tyrannei der Mehrheit“ (1987) kannte nur Sieg oder Niederlage.
Es lässt sich also festhalten, dass auch der „bottom-up“-Ansatz der unmittelbaren Volksherrschaft nicht der Königsweg für eine ökologisch-nachhaltige Transformation ist. Doch wie sollen wir Transformation als Prozesse kollektiven Bewusstseins- und Kulturwandels dann denken?
Der konsequent partizipative Ansatz
Transformation ist weder ausschließlich ein „top-down“- noch ein „bottom-up“-Prozess. Sie verlangt allen Vieles ab. Und sie verlangt den Mut und den Einsatz von „Treibern“, die früh erkennen, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Diese müssen den gesellschaftlichen Wandel forcieren, aber sie müssen ihn zu einem Prozess der ganzen Gesellschaft machen. Dieser Wandel kann nicht angeordnet werden – und er kann auch nicht drauf warten, dass auf wundersame Weise eines Tages direktdemokratische Mehrheiten dafür zustande kommen.
Diese „Treiber“ können Akteure in der Politik sein, auch in der Wirtschaft, ganz sicher aber in der Zivilgesellschaft. Dennoch können sie nur Wirksamkeit entfalten, wenn sie die Menschen mitnehmen. Transformation ist ein Miteinander – ein „side-by-side“. Denn nur wenn Treiber und Unterstützende, Lehrende und Lernende, Steuernde und Fordernde, Innovatoren und Konsument*innen zusammenkommen, kann nachhaltige Entwicklung gelingen. Es ist also an der Zeit, dass wir politisch die Notwendigkeit einer Verzahnung zwischen „top“ und „bottom“ anerkennen und unser repräsentatives Demokratiemodell dahingehend reformieren und verstärken. Die Anforderungen an neue Formen politischer Teilhabe sind dabei hoch. Denn zum einen bedarf es steuernder Leitplanken für Markt und Mensch. Zum anderen braucht es Raum für Bewusstseinsbildung und Mitsprache.
Dialogische Bürgerbeteiligung verkörpert genau diese Symbiose. Denn sie setzt weder alleine auf politische Teilhabe durch Wahlen, noch auf direktdemokratische Entscheidungsverfahren. Es geht vielmehr um die von Seiten der Treiber angestoßene Möglichkeit, üblicherweise entscheidungsunbefugte Akteursgruppen (bottom) an etablierten Entscheidungsprozessen (top) zu beteiligen. Partizipative Aushandlung in dialogischen Prozessen ist der Schlüssel zur Gestaltung der Transformation – sie ist ein langer, mühsamer, immer wieder in neue Stadien tretender Prozess des Aushandelns gesellschaftlichen Wandels. Denn dieser Wandel ist kein technischer Prozess, es gibt nicht immer ein „richtig“ oder „falsch“. Tatsächlich beruhen die einzuschlagenden Pfade in hohem Maße auf individuellen Werturteilen. Letztlich gibt es keine fachlich oder moralisch legitimierte Instanz, die vorgeben kann, wie eine Gesellschaft die Frage nach dem „guten Leben“ einheitlich zu beantworten hat. Eine Übereinkunft darüber, welches Ziel die Transformation hat, ist jedoch Grundvoraussetzung für ihre Umsetzung. Nur wenn die Ziele des Wandels gesellschaftlich ausgehandelt werden, können sich alle Akteure einer pluralistischen Gesellschaft in ihnen wiederfinden.
Dabei hängt die notwendige Partizipation eng mit Konzepten zusammen, die intra- und intergenerationale Gerechtigkeit als zentrales Element der Nachhaltigkeit verstehen. Die Idee ist, jedem Menschen jetzt und in Zukunft eine gute Lebensqualität zu sichern. Als Ausdruck prozessualer Fairness wird Partizipation so zum Garant gerechter Resultate – auch für nicht unmittelbar vertretene Anspruchsgruppen und Generationen. Die Erfahrungen gerade aus jüngerer Zeit belegen vielfach, dass Bürgerbeteiligung im Vergleich zu staatlich-repräsentativen Entscheidungsverfahren zu einer höheren Qualität gesellschaftlicher Entscheidungen führen kann. Dies liegt daran, dass Partizipation zur Emanzipation der Beteiligten beiträgt. Die Menschen werden von passiven Objekten politischer Willensbildung zu aktiven Subjekten der Gestaltung. Erst wenn die Bürgerinnen und Bürger zu politischer Teilhabe befähigt werden, können sie den Diskurs bereichern und zur besseren Lösung von Problemen des transformatorischen Prozesses beitragen. Beteiligung initiiert zudem einen Prozess sozialen Lernens, in dem Potenziale aber auch Nebenwirkungen des Wandels reflektiert werden und zu einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsdebatte beitragen. Ein gemeinsames Problemverständnis entsteht.
So erarbeitete gemeinsame Ziele führen ohne entsprechende Implementierung allerdings noch nicht zu tatsächlicher Transformation. Doch auch hier ist konsequente Partizipation der Schlüssel zur Lösung. Entscheidungen, die allein von repräsentativ-elitären Strukturen getroffen werden, leiden an mangelnder Transparenz und geringen Kontrollmöglichkeiten. Sie werden daher oft als unzureichend legitimiert wahrgenommen und stoßen auf Ablehnung. Bürgerbeteiligung kann die Einflussverluste der Bürger*innen auf Entscheidungen höherer Systemebenen kompensieren. Das hilft, die Akzeptanz von und Identifikation mit Nachhaltigkeitsbeschlüssen zu verbessern. Gesellschaftliche Akzeptanz wiederum ist eine Grundvoraussetzung für die breit unterstützte Umsetzung beschlossener Maßnahmen. Transformation verlangt also Partizipation.
Die notwendige Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft lässt sich weder ausschließlich von Oben vorschreiben noch von Unten organisieren. Zwar haben sowohl der hierarchische Steuerungsansatz der repräsentativen Demokratie als auch die direktdemokratische Form der Willensbildung wichtige Potenziale, doch sie können die tiefgreifenden Veränderungen alleine nicht gesellschaftlich akzeptiert ausgestalten. Transformation verlangt eine Verzahnung von Steuerungspolitik und Handlungsermächtigung. Sie ist ein dialogischer Prozess und kann deshalb letztlich nur partizipativ gedacht werden. Sie braucht Treiber. Sie braucht aber auch eine breite gesellschaftliche Debatte. Die damit verknüpfte politische Emanzipation der Bürgerinnen und Bürger bereichert den Diskurs und sichert Qualität und Akzeptanz der Veränderungsprozesse.
Letztlich braucht Transformation mutige Beschlüsse, die eine breite Akzeptanz durch umfangreiche Diskurse erfahren. Sie braucht: Konsequente Partizipation.