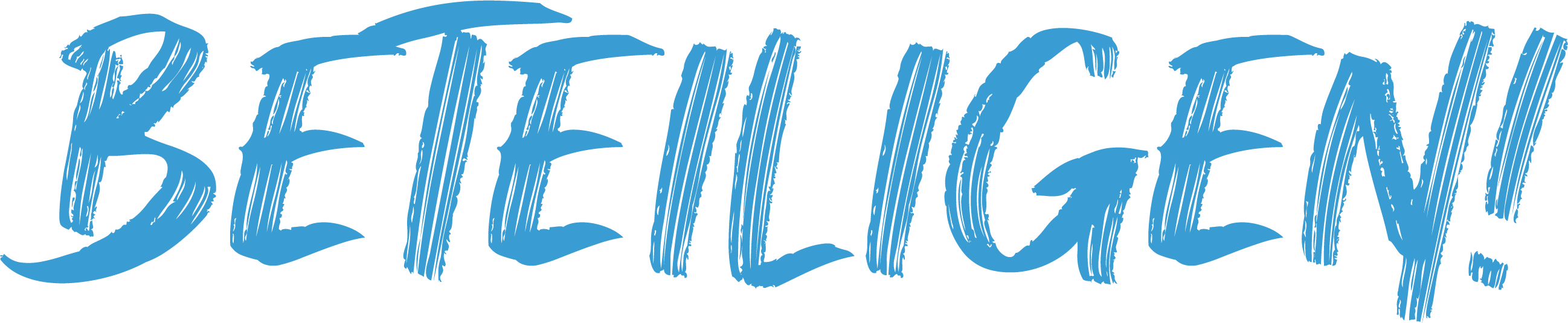Partizipation entspringt dem (evolutionären) Wunsch nach Selbstbestimmung. Diese Evolution prägt unsere Entwicklung ebenso, wie die aller Arten. In unserer Welt mit ihren unvorhersehbaren Ereignissen unterliegen alle Lebewesen einem Ausleseprinzip. Ein Exemplar, das – zufällig – eine etwas bessere Eigenschaft hat, ein Ereignis zu überstehen, kommt mit größerer Wahrscheinlichkeit durch und die anderen mit – zufällig – schlechteren Eigenschaften kommen um. Wenn außerdem bei jeder Zeugung immer mehrere Varianten entstehen, wird die Vielfalt vergrößert. Damit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Exemplar bei so einem Ereignis überleben kann und die Chance hat, dass die Art mit seinen speziellen Eigenschaften weiterleben kann. Eine Folge davon ist, dass es so aussieht, als wenn die Evolution Lebewesen Ziele mitgegeben hat, die den Erhalt der Art fördern. Menschen nennen diese Ziele „Werte“.
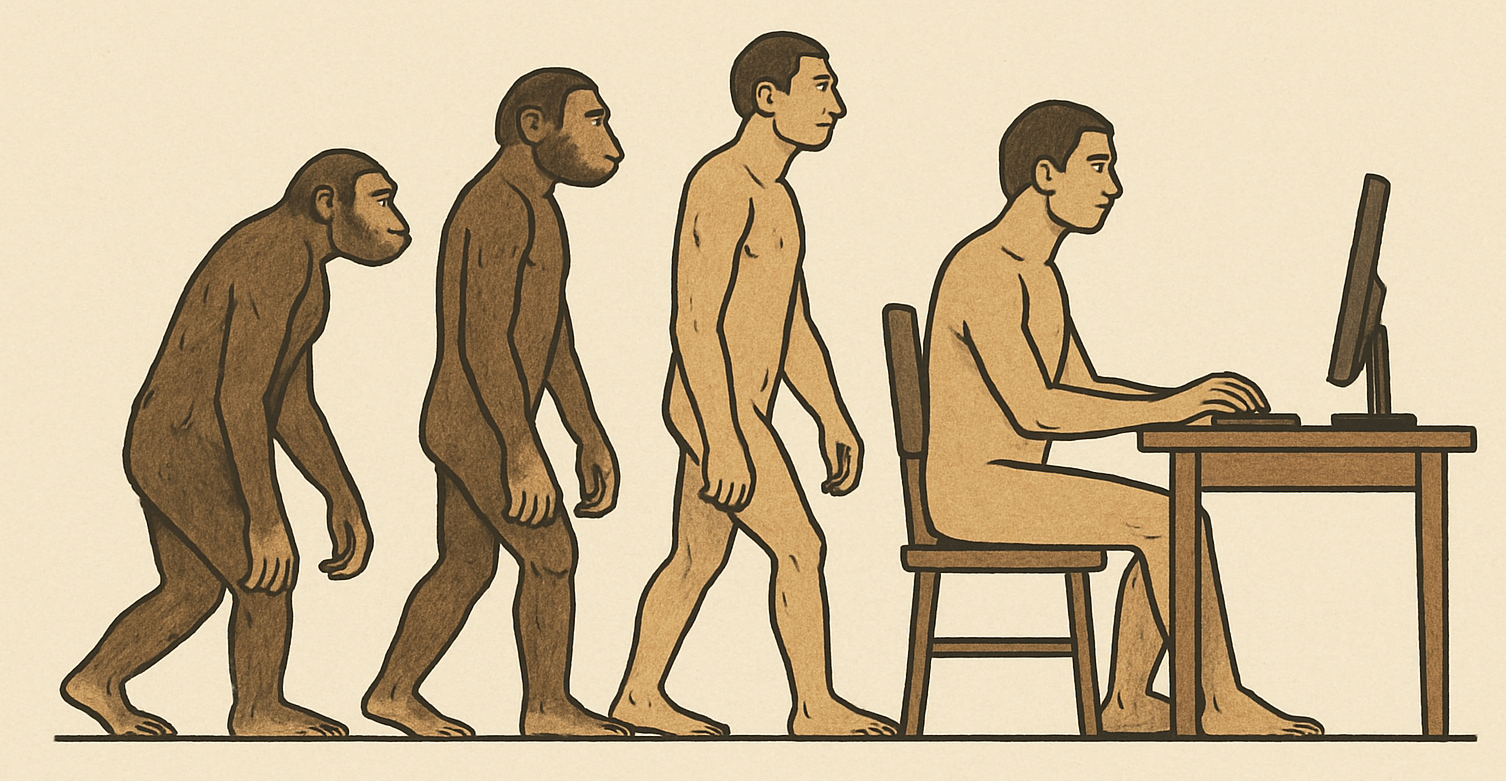
Partizipation ist ein Wert, der zur angeborenen Wertegruppe rund um Selbstbestimmung gehört. Die evolutionären Nutzen von Partizipation sind die Vergrößerung der Vielfalt (durch viele zusätzliche Ideen), die Stärkung von Kooperation und Vertrauen (in der Gruppe) und nützlichere, stabilere, bessere sowie langfristige Planung.
Der Mensch ist eine sehr kooperative Art. Die Wissenschaft sagt, er sei hypersozialisiert. Partizipation ist eine Form von Kooperation und braucht dazu ein Mindestmaß an Vertrauen: Kooperation ohne Partizipation ist ineffizient. Kooperation fördert das gegenseitige Vertrauen. Kooperation ohne Vertrauen ist unmöglich.
Partizipation trägt zur Willensbildung in der Gesellschaft bei und fördert somit unsere Demokratie. Demokratie ist eine traditionelle, althergebrachte Form der Partizipation. Demokratie verbessert die Überlebenschancen sehr großer Gruppen (Völker), braucht aber ihre Zeit. Diktaturen sind nur dann besser, wenn kurzfristige Entscheidungen unerlässlich sind. Letzteres ist selten und eher die Ausnahme. Partizipation ist nur in der Gruppe möglich, genauer nur in den äußeren Dunbarkreisen.
Die Dunbarkreise
Der englische Philosoph Robin Dunbar (geb. 1947) beschreibt die kognitiven Grenzen für Menschengruppen. Er bezieht sich auf eine theoretische Grenze von stabilen, bedeutungsvollen sozialen Beziehungen, die ein Mensch aufrechterhalten kann. Er teilt diese Beziehungen in konzentrische Kreise ein, deren Volumen von Kreis zu Kreis etwa um dem Faktor 3 zunimmt:
- Die innere Kreise: 5 enge Freunde oder Vertraute.
- Der nächste Kreis: 15 gute Freunde, mit denen regelmäßig kommuniziert wird.
- Der erweiterte Kreis: 50 Bekannte, die man persönlich kennt.
- Der Außenkreis: Bis zu 150 Personen, die man kennt, jedoch nicht täglich in Kontakt stehen.
Partizipation bedeutet, ein Mensch aus einem inneren Kreis nimmt an der Planung in einem außen liegenden Kreis teil. Dies nennen wir heute bei weit außen liegenden Kreisen Demokratie und bei weiter innen liegenden Kreisen Bürgerbeteiligung. Möglichkeiten zur Partizipation gibt es aber noch in viel mehr Gruppen: Beispielsweise Mitarbeiterbeteiligung in Firmen, Unternehmen (Betriebsräte), Kliniken (Ärzte, Helfer) und Schulen (Lehrer). Mitgliederbeteiligung in Vereinen oder in politischen Parteien. Schülerbeteiligung in Schulen & Bildungseinrichtungen, Studenten in Universitäten. Kundenbeteiligung im Marketing. Verbraucherbeteiligung im Markt (bezogen auf definierte Produktklassen). Fahrgastbeteiligung in Transportunternehmen. Patientenbeteiligung in Krankenhäusern. Oder auch Beteiligung in der Justiz (Schöffen).
Aktuell beobachten wir, dass Partizipation immer wichtiger wird. Dafür gibt es gute Gründe: Wenn Technik uns mehr und mehr alltägliche Aufgaben abnimmt, haben wir mehr Zeit, uns mit langfristigen Planungen zu beschäftigen. Zunehmende Digitalisierung macht Partizipation heute auch für größere Gruppen möglich: Städte, Länder oder sogar Staaten.
Nichts geht ohne Werte
Damit Partizipation gelingt, sind – neben Selbstbestimmung – weitere Werte relevant. Dies ist nichts Besonderes, sondern gilt immer bei menschlichen Handlungen.
Grundsätzlich sind eigentlich alle Werte zu berücksichtigen. Der Mensch hat etwa 140 verschiedene Werte. Sie sind zu finden z.B. im Lexikon der Werte. Die meisten sind angeboren, einige davon sind aber auch anerzogen und werden mit unserer Kultur „vererbt“ bzw. weitergegeben. Von diesen vielen Werten sind – wie immer – einige für das Thema wichtiger als andere. Die Wichtigkeit ist – wie immer – je nach Situation und je nach Teilnehmer unterschiedlich. Im Folgenden sind die für Partizipation wichtigsten Werte beispielhaft aufgelistet (ohne Anspruch auf absolute Richtigkeit).
- Individuum:
Selbstbestimmung, Neugier, Selbstvertrauen, Freiheit, Intelligenz, Weisheit, Fantasie, Authentizität, Weitsicht, Klugheit, Freiwilligkeit, Disziplin, Ausgeglichenheit, Fröhlichkeit, Humor, Freude, Ruhe, Wachsamkeit, Interesse, Wachsamkeit, Kreativität, Motivation, Sensibilität, - Gruppe:
Anerkennung, Wertschätzung, Freundlichkeit, Gleichberechtigung, Solidarität, Heimat, Verantwortung, Frieden, Zuversicht, Pragmatismus, - Leitung:
Führung: Neutralität, Gelassenheit, Professionalität, Geduld, Kontrolle;
Organisation: Flexibilität, Agilität, Effizienz, Realismus, Konsequenz;
Kommunikation: Aufmerksamkeit, Besonnenheit, Aufgeschlossenheit, Aktualität;
Auswertung: Aktivität, Fleiß, Sorgfalt
Im Folgenden wollen wir die sieben für Partizipation wichtigsten Werte einzeln betrachten und untersuchen, wie sie in Partizipationsverfahren berücksichtigt werden können – und sollten. Selbstverständlich sind die anderen Werte auch wichtig und sollten auch berücksichtigt werden – aber eben mit abnehmender Wichtigkeit.
Der folgende Inhalt ist nur für unsere Mitglieder zugänglich. Bitte logge dich ein, wenn du Mitglied im Fachverband Bürgerbeteiligung bist.