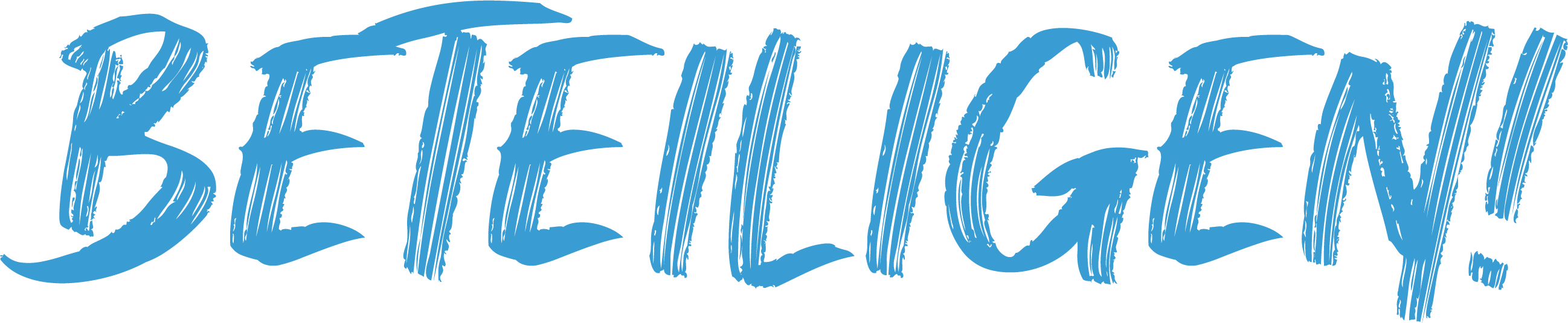Dass Demokratien ihre Bürger an wichtigen Entscheidungen beteiligen sollten, ist fast schon eine Binse. Wer würde dem ernsthaft widersprechen? So ist das jedenfalls in der Theorie. In der Praxis zeigt sich dagegen jeden Tag, wie kompliziert und mühsam es für Politiker, Unternehmen und durchaus auch für die Gesellschaft werden kann, wenn man den sogenannten Bürger erst einmal einbezogen hat. Oder er sich – meist wird’s dann erst richtig kompliziert – von selbst meldet. Es gibt wenige Bereiche, in denen das in den vergangenen Jahren so sichtbar wurde wie bei der Frage, wo unser Strom herkommt.
Als Journalist habe ich immer wieder über Energiewendeprojekte berichtet, die von Bürgern verhindert oder zumindest ausgebremst wurden. Die sich um Jahre verzögerten oder um Milliarden verteuerten. Mal ging es um einen Windpark, der die Chemieindustrie mit grünem Strom versorgen sollte. Mal um eine Stromtrasse. Oder auch mal um eine Gemeinde, die weg wollte von Putins Gas.
Jeder dieser Fälle hatte seine eigenen Besonderheiten, seine eigenen Bürger, mit sehr individuellen Wünschen und Bedenken. Und doch habe ich immer wieder Parallelen feststellen können. Ähnliche Fehler, die von Politikern und Unternehmen gemacht wurden. Aber auch ähnliche Erfolgsrezepte, die dazu beigetragen haben, beides zu vereinbaren: eine Beteiligung der Bürger und die Fertigstellung von Projekten, die zum Teil ja dringend notwendig sind.
Diese drei Punkte sollten aus meiner Sicht immer bedacht werden, wenn es darum geht, wie man Bürger an politischen Entscheidungen beteiligt.
Erstens: Die Politik muss Fragen beantworten, sonst tun es andere
Im Winter 2023/2024 war ich mehrere Male in der kleinen Gemeinde Mehring im äußerten Südosten Bayerns, weil dort ein Konflikt entbrannte, der mich wegen seiner vielen Widersprüche interessierte. Die Gegend wird auch als Chemiedreieck bezeichnet. Tausende Jobs hängen hier an Firmen wie Wacker, die es besonders schwer haben, von fossilen Rohstoffen loszukommen. Als die Firma Wacker vorschlug, vierzig Windräder in den Wald bei Altötting zu stellen, um das Chemiedreieck mit grüner Energie zu versorgen und damit das Überleben des Standorts zu sichern, war der Widerstand allerdings heftig.
Das lag aber nicht nur am großen Konfliktpotential, das solche Projekte immer haben. Die bayerische Landesregierung hatte es auch versäumt, die Bürger rechtzeitig mit Details über das Projekt zu informieren. Antworten zu geben über die Geräuschentwicklung eines Windrads, den Flächenverbrauch, den Stromertrag. So füllte schnell eine Bürgerinitiative dieses Vakuum und verunsicherte die Menschen mit Aussagen über die Windkraft, die zum Teil wissenschaftlich widerlegt waren. Auch ein örtlicher AfD-Politiker mischte dabei mit. Ein Telegram-Kanal entstand, in dem Links zu rechten Portalen und Verschwörungsmythen kursierten. Als die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden von der Landesregierung Hilfe in Form von seriösem Informationsmaterial bekamen, hatten viele Bürger blöderweise schon eine Meinung: Bloß keine Windräder.
Zweitens: Beteiligen heißt nicht nur, den Menschen zuzuhören
Wenn es einem Bürgermeister in Bayern gelingt, einen Windpark zu bauen, kam das lange fast schon einem Wunder gleich. Windräder in Bayern? Lohnen sich nicht, hieß es jahrelang auf Seiten der Gegner. Manche behaupten das bis heute. Erwin Karg aus Fuchstal im Landkreis Landsberg ist das Wunder gleich zweimal gelungen. Weil er den Menschen gezeigt hat, dass sich Windräder in Bayern sehr wohl lohnen können.
Fuchstal hat seine Bürger schon beim ersten Windpark eine finanzielle Beteiligung an den Gewinnen angeboten. Und geliefert. Sechs Prozent waren es 2018, achtzehn Prozent 2019, sieben Prozent 2020. Als Erwin Karg dann 2022 den zweiten Windpark bauen lassen wollte, war der Widerstand fast wie weggeblasen – und die Gemeinde konnte sich kaum retten vor Anfragen von Bürgern, die sich diesmal auch an den Windrädern beteiligen wollten.
Drittens: Die Suche nach einer Lösung, die jedem gefällt, ist sinnlos
Nach der Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 entschied die damalige schwarz-rote Bundesregierung, aus der Kernenergie auszusteigen. Weil dadurch im industriestarken Süden absehbar Strom fehlen würde, empfahlen die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber schon bald den Bau mehrerer großer Stromautobahnen. Sie sollten künftig die Energie aus dem windreichen Norden in den energiehungrigen Süden transportieren. So richtig los geht es mit dem Bau der Trassen aber erst jetzt, nach 13 Jahren, in denen die Stromkunden Milliarden zahlen mussten für Eingriffe ins Netz, die durch die fehlenden Kapazitäten nötig geworden waren.
Es war der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, der 2015 wegen des heftigen Widerstands vieler Bürger durchsetzte, dass die Stromautobahnen unterirdisch verlegt werden sollten. Das ist viel komplizierter, viel teuer – und brachte trotzdem keine Ruhe. Statt Anwohnern waren es jetzt oft die Landwirte, die sich empörten über die Leitungen. Die Angst hatten, dass die Kabel, die durch ihre Äcker verlaufen würden, durch die entstehende Wärme ihre Ernte zerstören.
Im Ergebnis hat sich die Stromautobahn Südlink massiv verteuert, niemand kann sicher sagen, wann sie zur Verfügung steht. Und man kann aus diesem Fall eines lernen: Politiker müssen Bürger beteiligen, ihre Bedenken berücksichtigen. Aber eine Lösung, die jedem Bürger gefällt, die gibt es in der Regel nicht.