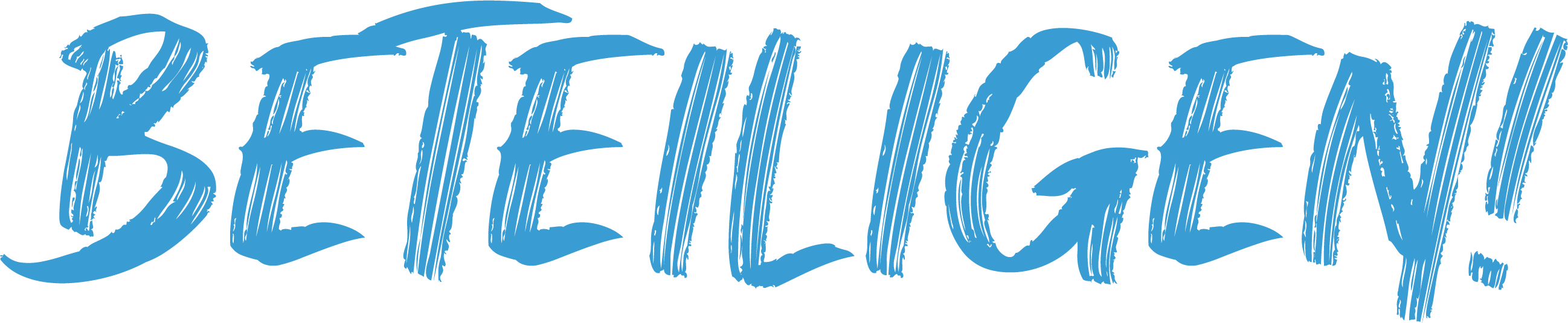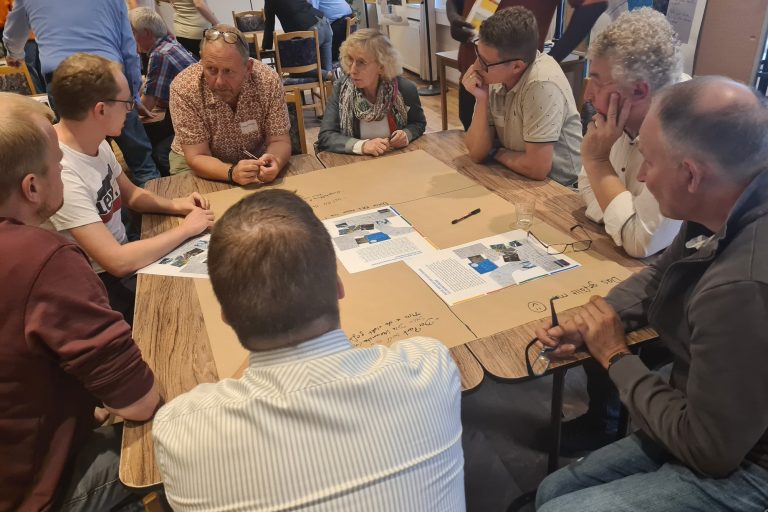Eine Bevölkerung in Zukunftsangst. Parteien, deren Ruf immer mehr leidet. Medien, die immer weniger Menschen erreichen. Und denen immer weniger Menschen glauben. Wellen des Hasses gegenüber ehren- und hauptamtlichen Politiker*innen, gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe, anderem Glauben, anderer Nationalität. Wähler, die immer weiter zu den Rändern wandern. Immer frechere Demokratieverächter*innen in den Parlamenten. Mit der Aussicht, bei der nächsten Wahl stärker als jede demokratische Partei zu werden.
Der Satiriker Jan Böhmermann sagte neulich: „Wer immer schon mal wissen wollte, wie ‚das mit den Nazis‘ in Deutschland ‚damals einfach so passieren konnte‘, lebt jetzt in der richtigen Zeit.“
Aber stimmt das? Ganz offensichtlich gibt es Parallelen in der deutschen Geschichte. Erneut gibt es Gegner der Demokratie und der freiheitlichen solidarischen Gesellschaft, die weder Anstand, noch Moral, noch Skrupel kennen.

Hass und Lüge als Geschäftsmodell
Erneut sind diese Gegner erfolgreich, weil sie Hass und Lüge als Geschäftsmodell entwickelt haben.
Beides sind ebenso leichte wie wirksame Hebel, um eine Gesellschaft zu zermürben. Wer die Sorge hat, zu den Verlierern einer Krise zu gehören, sich aber ohnmächtig fühlt, der ist frustriert und damit empfänglich für die Präsentation von Schuldigen, auf die er seinen Frust projizieren kann, der längst zum Zorn geworden ist, und seinen Höhepunkt im Hass findet.
Wer die Sorge hat, zu den Verlierern einer Krise zu gehören, sich aber ohnmächtig fühlt und deshalb die rücksichtslose Wahrheit als unerträglich empfindet, der glaubt gern der geschmeidigen Lüge. Als kongeniales Duo sind Lüge und Hass das perfekte Angebot der Demokratiefeinde seit es die Demokratie gibt. Also alles wie beim letzten Mal? Mit dem gleichen, unausweichlichen Ergebnis?
Nein. Denn während die Gegner der Demokratie ein 100 Jahre altes Konzept neu auflegen, haben wir Demokratinnen und Demokraten gelernt. Auch und gerade, weil wir nun seit einem dreiviertel Jahrhundert in einer Demokratie leben. Weil wir mit anderen Demokratien leben. Mit Ihnen sogar ein demokratisches und freiheitliches Europa aufgebaut haben. Weil wir dieser demokratischen Tradition nicht nur die längste Friedenszeit in der deutschen Geschichte verdanken, den größten Wohlstand und die größte Freiheit, die wir jemals hatten.
Und weil zu einer Demokratie eben auch gehört, dass sie sich ständig hinterfragt, auf vergangene Entscheidungen kritisch zurückblickt und den aktuell Regierenden das Regieren nicht allzu leicht macht.
Wir wissen heute sehr viel besser als vor 100 Jahren, was Demokratien stärkt. Wir wissen, was sie schwächt. Was sie lähmt. Und was sie umbringt. Wir haben also viel gelernt. Aber haben wir genug gelernt? Und vor allem: Setzen wir um, was wir gelernt haben? Die Antwort lautet: nicht wirklich konsequent. Denn der demokratische Weg, gesellschaftliche Probleme zu bearbeiten, hat einige gravierende Nachteile. Er braucht Zeit, Nerven, Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz. Und den Umgang damit, Recht zu haben, aber keine Mehrheit.
Demokratie ist schmerzhaft, unbequem, manchmal lästig und selten der kürzeste Weg zu einem Ergebnis. Deshalb praktizieren wir sie allzu häufig nur dann, wenn wir es müssen.
Demokratie ist mehr als Wahlen
Unsere Demokratie kann weitaus mehr, als wir ihr zutrauen und uns zumuten wollen. Demokratie beruht auf freien Wahlen. Doch Demokratie ist keine Wahltechnik, auch keine Herrschaftsform. Demokratie ist ein Modell des Zusammenlebens von Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, Sichtweisen und Interessen. Wer Demokratie auf Wahlen reduziert, macht sie schwach. Und damit anfällig.
Wer sie so versteht, sieht tatsächlich wenig Handlungsmöglichkeiten. Das Einzige, was bleibt, ist die „Gegner“ zu identifizieren – und zu bekämpfen.
Doch wer sich bei der Stärkung der Demokratie auf deren Gegner fokussiert, der gerät schnell in die Defensive. Auch deshalb, weil das mit „dem“ Gegner gar nicht so leicht ist. Björn Höcke, Chef der AfD in Thüringen, schon wieder Thüringen, darf gerichtsfest als Faschist bezeichnet werden. Weit über eine Million Menschen haben einen Aufruf unterzeichnet, ihm die Bürgerrechte zu entziehen. Das ist verständlich. Aber wer glaubt ernsthaft, dass man damit die Demokratie retten könnte?
Nazis als Nazis zu beschimpfen, hilft nichts. Deren Wähler*innen so einzusortieren, bewirkt sogar das Gegenteil. Demokratie zu stärken, indem man deren Gegner lokalisiert und „bekämpft“, ist verlockend und verführerisch. Aber ist es auch wirksam? Denn an der Legitimität unserer demokratischen Institutionen, Akteure, Prozesse und Entscheidungen kratzen ja längst nicht nur die Höckes dieser Welt.
Die Zahl der Menschen, die mit der Demokratie in ihrer aktuellen Ausgestaltung hadern, ist groß. Diese Menschen wahlweise zu beschimpfen, zu belächeln oder gar belehren zu wollen, wird sie nicht zu „besseren“ Demokraten machen.
Vor diesem Hintergrund ist es die Suche nach der Antwort auf eine essentielle Frage, die sich lohnt:
Was macht Menschen eigentlich zu Demokraten?
Wir definieren Demokratie als Menschenrecht. Das heißt aber nicht, dass sie allen Menschen angeboren ist. Wir dürfen nicht dem Glauben erliegen, Menschen würden als Demokraten geboren, und alle, die dann irgendwann keine mehr sind, wären irgendwie dysfunktional.
Demokratie ist eine Einstellung und eine Kulturtechnik. Beides ist keine Frage der Gene, sondern der kulturellen Aneignung. Manche würden es Bildung nennen, andere Training. Demokratische Einstellung hat etwas mit drei Dingen zu tun. Mit Kompetenz, mit Bereitschaft und mit Wirksamkeit.
Gerade die Wirksamkeit ist hier ein Schlüsselbegriff. Demokrat wird man nicht, weil man die Funktion des Bundestages und das deutsche Wahlrecht in der Schulklausur unfallfrei beschreiben kann. Sondern, indem man sie erlebt. Wir wissen heute sehr genau, dass frühe Selbstwirksamkeitserfahrung oft lebenslange demokratische Wirksamkeit triggert. Erfahre ich Selbstwirksamkeit, erhöht dies tatsächlich meine Bereitschaft, mich auch in anderen Zusammenhängen auf Diskurse, Dialoge und demokratische Prozesse einzulassen.

Lasse ich mich darauf ein, steigere ich meine Diskurskompetenz. Und die ist eben nicht nur Rhetorik, sondern auch Zuhören können, Eingehen auf die Interessen anderer, Wertschätzung auszudrücken und mit Kritik umzugehen.
Erst diese Diskurskompetenzen ermöglichen mir, auch eine der wesentlichen Kompetenzen in einer Demokratie zu entwickeln: Verlieren zu können. Es auszuhalten, wenn ich nicht in der Mehrheit bin. Ergebnisse zu akzeptieren, die mir nicht gefallen – und demokratische Wege zu bestreiten, um weiter für meine Ziele einzutreten. Je besser ich das beherrsche, je ausgeprägter meine Demokratiekompetenz, desto größer ist eine Chance auf weitere Selbstwirksamkeitserfahrung. So schließt sich der Kreis.
Wenn Menschen also mit Demokratie wenig anfangen können, sollten wir darüber nachdenken, wie wir ihnen mehr davon anbieten können, statt weniger. Genau hier kommen die zahlreichen Prozesse und Formate der Bürgerbeteiligung ins Spiel, die schon heute in vielen deutschen Kommunen praktiziert werden. Sie sind das perfekte Training für Diskurskompetenz, Frustrationstoleranz aber eben auch für Selbstwirksamkeit.
Die gute Nachricht lautet also: Demokratie können wir stärken. Indem wir demokratische Erfahrungen organisieren. Doch dazu bräuchten wir weit mehr konkrete Beteiligung als bisher. In unseren Kommunen, aber auch in unseren Schulen.
In der aktuellen Politik ist diese Erkenntnis noch nicht durchgedrungen. In den über 100 Seiten des aktuellen Koalitionsvertrages steht dazu: gar nichts. Noch immer ist die Demokratiestärkung durch Beteiligung oft eher ein mehr oder weniger zufälliger Kollateralnutzen. Von einer systematischen Stärkung unserer Demokratie durch diese Formate sind wir deutlich entfernt.
Insofern ist der Titel des neuen digitalen Magazins, in dem dieser Beitrag erscheint, wunderbar gewählt. Denn genau das ist der Hebel für eine starke, widerstandsfähige Demokratie:
Beteiligen!