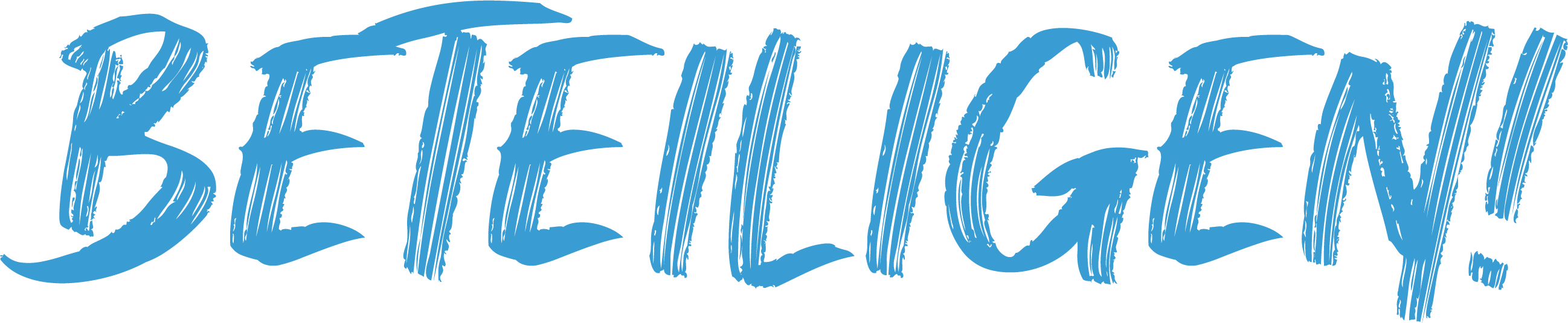Ist unsere Demokratie gefährdet? Kann sie durch Bürgerbeteiligung gerettet werden? Die Antwort auf die erste Frage ist ein klares Ja. Jahrelange Umfragedaten belegen einen kontinuierlichen Vertrauensverlust in politische Institutionen sowie eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. Die jüngsten Wahlerfolge der AfD bei Bundes- und Landtagswahlen zeigen, dass rechtsextreme und populistische Kräfte an Einfluss gewinnen. Parallel dazu steigen Hasskriminalität, Rassismus und Diskriminierung. Erste Einschüchterungsversuche gegenüber zivilgesellschaftlichen Organisationen und Aktivisten sind zu beobachten. Schon lange wird kritisiert, dass Lobbyisten politische Entscheidungsprozesse beeinflussen. Zwar gibt es in Deutschland – anders als etwa in den USA – noch keine Anzeichen für eine systematische Aushöhlung demokratischer Prinzipien wie Medienkontrolle oder Angriffe auf die Unabhängigkeit von Justiz und Wissenschaft. Doch eines steht fest: Unsere Demokratie ist in Gefahr.
Nicht alle wollen, dürfen oder können mitmachen
Aber an der hoffnungsvollen These, dass Bürgerbeteiligung ein demokratieförderndes Instrument ist, müssen erhebliche Zweifel bestehen. Natürlich können Bürgerbeteiligungsprozesse bei den Teilnehmenden das Verständnis für politische Abläufe vertiefen, neue Perspektiven eröffnen, Lerneffekte bewirken, Gemeinschaftsgefühle stärken und Selbstwirksamkeit vermitteln. Aber eben nur bei denjenigen, die auch teilnehmen. Und hier beginnt das Problem: Es gibt zu viele Menschen, die nicht mitmachen wollen, mitmachen dürfen oder mitmachen können.
Erstens, auch wenn es umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit und gezielte aufsuchende Ansprache gibt, erreichen Bürgerbeteiligungsangebote nicht alle Menschen. Manche erfahren gar nicht von einer für sie relevanten Beteiligung, andere haben schlicht kein Interesse, daran teilzunehmen. Die Gründe sind vielfältig: Der Gegenstand mag zu weit sein von ihrer Lebenswirklichkeit, sie bevorzugen Freizeitaktivitäten oder sind nicht motiviert. Hinzu kommen jene, die sich aus Misstrauen nicht beteiligen – sie unterstellen den Auftraggebern Scheinbeteiligung und den Prozessgestaltern Manipulation. Oder sie haben negative Erfahrungen mit Beteiligung gemacht, weil zum Beispiel Ergebnisse ignoriert wurden. Ob aus Unwissenheit, Desinteresse oder bewusster Abwehr: Es gibt Menschen, die wollen sich einfach nicht beteiligen.
Ein anderes Problem sind zweitens strukturelle Ausschlüsse, die in bestimmten Beteiligungsmethoden angelegt sind. Verfahren, bei denen bewusst nur offizielle Vertreter von Interessengruppen eingeladen werden, finden in der Regel unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Hier ist eine Teilnahme weiterer Interessierter nicht vorgesehen. Bei losbasierten Beteiligungsverfahren dürfen nur diejenigen Menschen teilnehmen, die aufgrund bestimmter sozialdemographischer Kriterien ausgelost wurden. Eine eigene Teilnahmebewerbung ist nicht möglich. Wenn aber nur zufällig Ausgewählte mitmachen dürfen, kann das von den anderen Bürgerinnen und Bürgern als ungerecht empfunden werden, und die unmittelbar Betroffenen könnten die Ergebnisse nicht anerkennen. Hier ist das Problem, dass sich Menschen beteiligen wollen, das aber nicht dürfen.
Drittens, scheitert die Teilnahme an Bürgerbeteiligung vielfach an persönlichen Hürden. Beteiligungsprozesse sind nicht selten zeitintensiv und erfordern kognitive Ressourcen, die viele aufgrund von Beruf, Familie oder Mangel an Energie nicht aufbringen können. Soziale Ängste, fehlende digitale Ausstattung oder mangelnde Diskussionserfahrung verstärken diese Barrieren. In diesen Fällen wollen sich Menschen beteiligen, können das aber aufgrund ihrer Disposition oder ihrer Lebensumstände nicht.
Alle diese Hindernisse lassen sich entweder gar nicht oder nur mit Hilfe aufwendiger und kostenintensiver Rekrutierungsmaßnahmen überwinden. Selbst bei größten Anstrengungen wird es immer eine signifikante Gruppe geben, die durch Bürgerbeteiligung nicht erreicht wird – und die somit auch nicht von den Vorzügen der Demokratie überzeugt werden kann.
Wunderheilung der Demokratie durch Beteiligung?
Darüber hinaus stellt sich die grundsätzliche Frage, ob Menschen aufgrund gelegentlicher oder zufälliger Einbindung in politische Prozesse überhaupt (wieder) Vertrauen in die Demokratie gewinnen können. Warum sollte jemand, der einmal in einem Beteiligungsverfahren seine Meinung zu einem kontroversen Thema sagen oder einen Vorschlag zu einem ungelösten Problem machen durfte, plötzlich weniger politikverdrossen sein als vorher? Warum sollte die einmalige Teilnahme an einem – im besten Fall herrschaftsfreien – Diskurs demokratiefeindliche Einstellungen beseitigen?
Aktuelle Beobachtungen sprechen dagegen. Bei den letzten Landtags- und Bundestagswahlen feierte die AfD große Erfolge – selbst in Bundesländern mit ausgeprägter Bürgerbeteiligungskultur. In Sachsen, wo das offizielle Bürgerbeteiligungsportal im April 2025 über 700 Verfahren verzeichnete, gewann die AfD bei der letzten Bundestagswahl in 15 von 16 Wahlkreisen die meisten Erststimmen. Auch in Baden-Württemberg, wo die „Politik des Gehörtwerdens“ gewissermaßen zur Staatsräson geworden ist, wurde die AfD 2025 zweitstärkste Kraft. Diese Entwicklungen legen nahe, dass Bürgerbeteiligung nicht automatisch zu einer Abnahme rechtspopulistischer Wählerstimmen führt.
Liegt das möglicherweise daran, dass es immer noch zu wenig Bürgerbeteiligung gibt? Aber wie viele Beteiligungsangebote wären denn nötig, um Politikverdrossenheit zu überwinden? Könnte womöglich ein Zuviel an Beteiligung zu „Partizipationsmüdigkeit“ führen? In der Schweiz, wo verbindliche Volksabstimmungen eine niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeit sind, nimmt im Durchschnitt mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger nicht an den Abstimmungen teil. Wie hoch wäre diese Quote bei komplexen, unverbindlichen Bürgerbeteiligungsverfahren?
Auch die Nachhaltigkeit von positiven Beteiligungserfahrungen ist fraglich. „Vertrauen ist eine zarte Pflanze; ist es zerstört, so kommt es sobald nicht wieder.“ soll Otto von Bismarck gesagt haben. Selbst wenn jemand eine Bürgerbeteiligung positiv bewertet, können gebrochene Wahlversprechen, permanente Koalitionsstreitigkeiten oder politische Skandale die positiven Effekte schnell und dauerhaft wieder verpuffen lassen. Bürgerbeteiligung mag die Demokratiezufriedenheit kurzfristig steigern, doch langfristig ist ihre Wirkung begrenzt.
Schließlich bestimmen die gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse die Einstellung zur Demokratie. In einem Sozialstaat hängt politische Unterstützung stark von der wirtschaftlichen Lage der Menschen ab und eher nicht von ihren Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten. Dementsprechend ordnet Abraham Maslow in seiner Bedürfnispyramide Partizipation erst nach den Grund- und Sicherheitsbedürfnissen ein. Wer existentielle Nöte hat und in prekären Verhältnissen lebt, setzt andere Prioritäten. Bertold Brecht hat das prägnant auf die Formel gebracht „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“
Die Gleichung „Mehr Bürgerbeteiligung = höhere Demokratiezufriedenheit“ geht also leider nicht auf. Denn es geht den meisten Menschen nicht um Bürgerbeteiligung selbst, sondern um die gesellschaftlichen Themen, die damit bearbeitet werden. Der Kampf gegen Politikverdrossenheit und die Schaffung von Vertrauen in die Demokratie erfordern weit mehr als Bürgerbeteiligung.
Warum Bürgerbeteiligung dennoch unverzichtbar ist
Aber: ohne Bürgerbeteiligung geht es auch nicht. Demokratiezufriedenheit kann weder durch Zwang noch durch gutes Zureden erreicht werden. Nur dann, wenn Menschen positive Beteiligungserfahrungen gemacht haben, gibt es überhaupt eine Chance, Politikverdrossenheit bei ihnen abzubauen und Demokratiezufriedenheit herzustellen. Und nur mit mehr und immer wiederkehrenden – und vor allem mit guten – Beteiligungsangeboten können diejenigen erreicht werden, die bisher nicht teilnehmen wollen, dürfen oder können.
Die Aktivierung derjenigen, die nicht wollen ist – wie beschrieben – kaum möglich. Die Aktivierung derjenigen, die nicht können, ist grundsätzlich möglich, aber aufwendig und teuer. Vergleichsweise einfach ist dagegen, diejenigen zu beteiligen, die aufgrund des gewählten Beteiligungsverfahrens daran gehindert sind. Aber dazu dürfen nicht länger einzelne Beteiligungsformate synonym mit Bürgerbeteiligung gesetzt werden, sondern es muss eine Methodenvielfalt zum Einsatz kommen. Eine kluge Methodenkombination muss dafür sorgen, dass nicht nur gezielt Eingeladene oder zufällig Ausgeloste mitmachen dürfen, sondern alle, die das wollen.
Bürgerbeteiligung ist ein kleiner Baustein zur Stärkung der Demokratie – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dies jedoch nur, wenn sie sich an den Lebensrealitäten der Menschen orientiert und sich dabei durch sorgfältig konzipierte Beteiligungsprozesse auszeichnet. Es sind Beteiligungsangebote nötig, die sich strikt an den allgemein anerkannten Qualitätsstandards orientieren – und dazu gehört auch, eine breite Beteiligung sicher zu stellen und nicht Betroffene oder Interessierte auszuschließen. Das ist anspruchsvoll – aber alternativlos.
Nur so kann Bürgerbeteiligung vom kleinen Baustein zum Schlussstein der Demokratie werden.